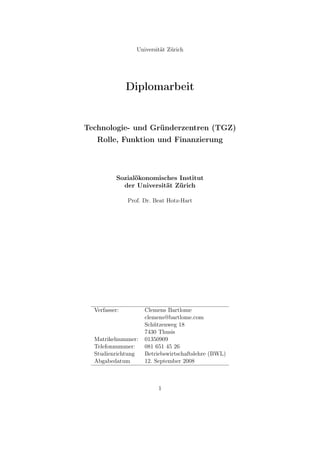
Technologie- und Gründerzentren (TGZ) Rolle, Funktion und Finanzierung
- 1. Universität Zürich Diplomarbeit Technologie- und Gründerzentren (TGZ) Rolle, Funktion und Finanzierung Sozialökonomisches Institut der Universität Zürich Prof. Dr. Beat Hotz-Hart Verfasser: Clemens Bartlome clemens@bartlome.com Schützenweg 18 7430 Thusis Matrikelnummer: 01350909 Telefonnummer: 081 651 45 26 Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre (BWL) Abgabedatum 12. September 2008 1
- 2. Eidesstattliche Erklärung Der Verfasser Clemens Bartlome erklärt an Eides statt, dass er die vorliegende Arbeit selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als die angegebenen Hilfs- mittel angefertigt hat. Die aus fremden Quellen (einschliesslich elektronischer Quellen) direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos als solche kenntlich ge- macht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden. Zürich, 12. September 2008 Clemens Bartlome 2
- 3. Zusammenfassung Technologie- und Gründerzentren (TGZ) sind Umgebungen, deren Ziel es ist, das Jung- unternehmertum zu fördern und den Wissenstransfer zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft zu erleichtern. Dies um die Innovationstätigkeit einer Region zu steigern und so das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Frage nach der Rolle, Funktion und Finanzierung von TGZ. Die Thematik wird mit den wissenschaftlichen Kenntnissen eingeführt und erörtert. Es wird aufgezeigt, welche Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien zu TGZ vorliegen und wie diese zu bewerten sind. Dabei wird auf das Problem der Leistungsmessung verwiesen und auf die Schwierigkeit, aussagekräftige Indikatoren zu definieren. Ergänzend wird auf die Bedeutung von Innovationen bzw. Innovationsför- derung im wirtschaftspolitischen Kontext eingegangen, um den Praxisbezug von TGZ zu unterlegen und um eine ganzheitliche Betrachtung der Thematik zu ermöglichen. Für die Leistungsmessung der 16 Schweizer TGZ ist eine Umfrage in Form eines Online- Fragebogens durchgeführt worden. Die gewonnenen Daten wurden mit Informationen von den Websites der jeweiligen TGZ ergänzt und in einer Tabelle sowie in Porträts darge- stellt. Mit der Leistungsanalyse der Schweizer TGZ galt es zu testen, ob die Zentren die vier Erfolgsfaktoren Netzwerk zwischen den in den TGZ eingemieteten Unternehmen und den umliegenden Forschungs- und Ausbildungsstätten, Angemessenheit der Ziele, Unter- stützung des TGZ von aussen sowie Dienstleistungen und Anlagen, die im TGZ geboten werden erfüllen und ob sie die drei Kernaufgaben Vermittlung, Coaching und Selektion wahrnehmen. Zudem wurde untersucht, ob die TGZ mit öffentlichen Geldern unterstützt werden. Aus den Resultaten geht hervor, dass die befragten TGZ die gesetzten Bedingungen weitgehend erfüllen. Rund ein Drittel profitiert von Subventionen. Diese Diplomarbeit schliesst mit der Bewertung des Konzepts TGZ und diskutiert die Finanzierungsmodelle. 3
- 4. Inhaltsverzeichnis Eidesstattliche Erklärung 2 Zusammenfassung 3 Inhaltsverzeichnis 4 Abkürzungsverzeichnis 7 I. Einleitung 8 1. Themeneinführung 9 2. Einordnung 11 3. Material und Methoden 12 3.1. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.2. Methodisches Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 II. Herleitung der Aufgabenstellung 14 III. Wissenschaftliche Grundlagen 18 4. Definitionen und Datenlage 19 4.1. Innovationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.2. Die Wichtigkeit von Innovationen im historischen Kontext . . . . . . . . . 21 4.3. Wo und wie Innovationen entstehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.4. Definition und Bedeutung von Wissensspillover-Effekten . . . . . . . . . . 24 4.5. Definition und Bedeutung des Wissenstransfers . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.6. Definition und Bedeutung von Agglomerationseffekten . . . . . . . . . . . 25 4.7. Das Nationale Innovationssystem (NIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.8. Die Innovationstätigkeit der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.9. Technologie- und Gründerzentren (TGZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.9.1. Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.9.2. Klassifizierung von TGZ nach Kang . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.9.3. Verbreitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4
- 5. INHALTSVERZEICHNIS 4.9.4. Übersicht möglicher Kernaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.9.5. Ausgewählte Kernaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.9.6. Problematik der Leistungserfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.9.7. Erfolgsfaktoren von TGZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.9.8. Nutzen von TGZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.9.9. Rolle der TGZ in der staatlichen Innovationsförderung . . . . . . . 47 4.9.10. Staatliche Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5. Untersuchungsgegenstand 51 5.1. Die TGZ der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.2. Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 IV. Datenauswertung und Resultate 53 6. Beweggründe für die TGZ der Schweiz 54 7. Übersichtstabellen 57 7.1. Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7.2. Hinweis zur Lesbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7.3. Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 8. Porträts 61 8.1. Der Technopark R Zürich als erfolgreicher Erstling . . . . . . . . . . . . . 61 8.2. Technopark R Aargau, Windisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 8.3. E-Tower, Chur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 8.4. grow Gründerorganisation, Wädenswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8.5. START! Gründungszentrum, Frauenfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8.6. tebo, St. Gallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 8.7. FriUp, Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 8.8. The Ark, Monthey, Martinach, Sitten, Sider, Visp und Brig . . . . . . . . 67 8.9. Technopark R Winterthur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 8.10. businessparc, Reinach und Zwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 8.11. Centro Promozione START-UP, Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 8.12. TZW TechnologieZentrum, Witterswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 8.13. Parc Scientifique PSE, Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8.14. Neode, Neuenburg und La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 8.15. Y-Parc, Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 8.16. innoBE (GründerZentrum), Bern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 9. Bewertung der Schweizer TGZ 75 9.1. Messproblematik, Individualität und Datenmangel . . . . . . . . . . . . . 75 9.2. Beurteilung anhand der Erfolgsfaktoren nach Byung-Joo Kang . . . . . . 76 9.2.1. Angemessenheit der Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5
- 6. INHALTSVERZEICHNIS 9.2.2. Netzwerk zwischen den in den TGZ eingemieteten Unternehmen und den umliegenden Forschungs- und Ausbildungsstätten . . . . . 76 9.2.3. Unterstützung des TGZ von aussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 9.2.4. Dienstleistungen und Anlagen, die im TGZ geboten werden . . . . 77 9.3. Beurteilung anhand der Kernaufgaben von Bergek et al. . . . . . . . . . . 77 9.3.1. Selektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 9.3.2. Coaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 9.3.3. Vermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 10.Geschäftsmodelle und Finanzierung der Schweizer TGZ 79 V. Schlussteil 81 11.Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 82 12.Schlussfolgerung 84 Literaturverzeichnis 87 A. Begleitschreiben zum Fragebogen 94 B. Fragebogen 95 6
- 7. Abkürzungsverzeichnis BSP Bruttosozialprodukt EPFL Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (franz.: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) ETH Eidgenössische Technische Hochschule ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich EU Europäische Union FDP Freisinnig Demokratische Partei FPO For-Profit-Organisation FuE Forschung und Entwicklung IT Informationstechnik (engl.: information technology) IWF Internationaler Währungsfonds (engl.: International Monetary Fund) KMU Kleine und Mittlere Unternehmen KOF Konjunkturforschungsstelle der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich KTI Förderagentur für Innovation der Schweiz MNU Multinationales Unternehmen NIS Nationales Innovationssystem NPO Non-Profit-Organisation OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (engl.: Organisation for Economic Co-operation and Development) SECO Staatssekretariat für Wirtschaft der Schweiz TGZ Technologie- und Gründerzentren (Einzahl: Technologie- und Gründerzentrum) 7
- 9. 1. Themeneinführung “For centuries people assumed that economic growth resulted from the in- terplay between capital and labor. Today we know that these elements are outweighed by a single critical factor: innovation.” Bill Gates (2007)[34, S. B07] Ein halbes Jahrhundert nach der Eröffnung des ersten Science-Parks in den USA im Jahre 19591 und 15 Jahre nachdem der Technopark R Zürich seine Türen geöffnet hat[91, S. 307], scheint die Bearbeitung des Themas «Rolle, Funktion und Finanzierung von Technologie- und Gründerzentren (TGZ)»auf den ersten Blick wenig aktuell. Die Dis- kussion um die Nutzung des ausrangierten Militärflugplatzes Dübendorf ist jedoch bei- spielhaft für die fortwährende Aktualität des Themas. Die Stiftung Forschung Schweiz präsentierte am 14. September 2007 die Idee, auf dem brachliegenden 206 Hektar grossen Gelände einen Innovationspark mit internationaler Ausstrahlung zu errichten[90]. Anhand der Namensliste des Unterstützungskomitees ist die grosse Bedeutung des Projektes erkennbar2. Neben nationalen Politikern sind Vertreter aus Wirtschaft, Wis- senschaft und Bildung aufgeführt. Dies spiegelt sich auch in der Besetzung des Vorstandes der Stiftung wider. Der Initiant des Projektes Ruedi Noser3 ist Unternehmer und Na- tionalrat (FDP Schweiz), Peter Gomes ist Verwaltungsratspräsident von Swiss Financial Market Services und Alexander J. B. Zender amtet als Präsident des Rates der Eidge- nössischen Technischen Hochschule (ETH). Die Beteiligung von Vertretern unterschiedlicher Interessensgruppen kann als exempla- risch für ein solches Projekt zur Innovationsförderung in der Schweiz betrachtet werden. Ein Grund dafür ist, dass die Realisierung mit der Freigabe öffentlicher Leistungen ver- bunden ist. Weitaus bedeutender erscheint die Tatsache, dass die Innovationsförderung sowohl in Wirtschaft und Politik als auch in der Gesellschaft auf sehr grosses Interesse stösst. Sie ist verbunden mit der Hoffnung auf Wirtschaftswachstum und der Steigerung der materiellen Wohlfahrt. Gregory Daines (1999), damaliger Direktor des Cambridge Instituts für Technologie- transfer, äusserte gegenüber dem Magazin «The Economist»wie folgt[26, S. 26]: “Innovation has become the industrial religion of the late 20th century. Busi- ness sees it as the key to increasing profits and market share. Governments 1 Als erster Science-Park gilt das im Jahre 1959 eröffnete Batavia Industrial Center in den USA[39, S. 57]. 2 http://www.stiftung-forschung-schweiz.ch/d/komitee.php, zuletzt besucht am 7. August 2008 3 Nationalrat Ruedi Noser reichte das Postulate 06.3050 am 15. März 2006 beim Bundesrat ein. 9
- 10. 1. Themeneinführung automatically reach for it when trying to fix the economy. Around the world, the rethoric of innovation has re-placed the post-war language of welfare eco- nomics. It is the new theology that unites the left and the right of politics.” Technologie- und Gründerzentren (TGZ4) sind in diesem Sinne die Kirchen dieser „industriellen Religion“. Wallfahrtsorte sind der Cambridge Science-Park5 in Grossbri- tannien, der University Park MIT6 in den USA, die BioSquare of Boston7 (USA) und allen voran das IT-Cluster Silicon Valley in Kalifornien (USA). So war es denn auch der Traum, ein kleines Silicon Valley nachzubilden, der in den 90er Jahren zum Bau einer ganzen Reihe von TGZ auf der ganzen Welt geführt hat.8 Mit dem Platzen der Web- Blase wich der Hype um die TGZ einer abgeklärteren Einstellung gegenüber solchen Zentren9, dennoch scheint der Traum einer Innovationsmetropole nicht ausgeträumt und der Glaube an die Wirksamkeit der TGZ besteht nach wie vor. Diese Arbeit zeigt den heutigen Erkenntnisstand bezüglich der Rolle, Funktion und Finanzierung von TGZ auf und führt durch die wissenschaftliche Literatur. Der theoretische Teil der Arbeit (Teil III) gibt einen Überblick der wissenschaftlichen Grundlagen zu Innovationen, der Innovationsförderung und der TGZ. Im Ergebnisteil (Teil IV) wird der Status quo der TGZ-Landschaft der Schweiz beleuchtet und versucht, eine Leistungsanalyse dieser nationalen TGZ zu erstellen. Diese wird im abschliessenden Teil V in den internationalen Kontext gestellt. 4 TGZ = Technologie- und Gründerzentren. Vergleiche dazu die Definition in Abschnitt 4.9.1. 5 http://www.cambridgesciencepark.co.uk, zuletzt besucht am 7. August 2008. 6 http://www.universityparkliving.com, zuletzt besucht am 7. August 2008. 7 http://www.biosquare.org, zuletzt besucht am 7. August 2008. 8 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.3. 9 Vgl. dazu S. Wallsten (2004)[93]. 10
- 11. 2. Einordnung Diese Diplomarbeit zeigt im Teil III den aktuellen Forschungsstand zur TGZ-Problematik mit Schwerpunkt auf Rolle, Funktion, Finanzierung sowie Leistungsanalyse auf. Es wer- den theoretische Grundlagen und Überlegungen, welche zur Gründung solcher Zentren führen zusammengefast und übersichtlich präsentiert. Dabei orientiert sich die Arbeit an Erkenntnissen wissenschaftlicher Studien, die in unterschiedlichen Ländern durchgeführt wurden. Im Teil IV wird eine Auslegeordnung der Schweizer TGZ präsentiert. Eine solche Auf- listung besteht bisher nicht in diesem Umfang. Die anschliessende Leistungsanalyse dieser TGZ anhand der ausgewählten Leistungsindikatoren ist ebenfalls neu. 11
- 12. 3. Material und Methoden 3.1. Literatur Abgesehen von wenigen Veränderungen im Laufe der Zeit ist der Kern des TGZ-Konzeptes weitgehend konstant geblieben.1 Entsprechend gut ist das Thema in der Literatur doku- mentiert. Resultate und Erkenntnisse aus über 20 empirischen Studien sind online oder in gedruckter Form verfügbar[39, S. 56]. Dies hängt einerseits damit zusammen, dass TGZ oftmals eine enge Verbindung zu Forschungs- und Ausbildungsstätten haben und ande- rerseits, dass auch von wirtschaftspolitischer Seite eine Nachfrage nach Analysen besteht, zumal die Zentren in gewissen Ländern mit staatlicher Beteiligung realisiert werden. Deutlich wird dieser wirtschaftspolitische Aspekt z.B. in Südkorea. Um die Wirt- schaftskrise zu überwinden, förderte die Regierung der Halbinsel mit einem staatlichen Programm die Innovationsdynamik. Der Bau von TGZ war ein Bestandteil dieses Pro- gramms. Um den Umfang der staatlichen Unterstützung der geplanten Anlagen fest- zulegen, wurden diese anhand von Kriterien kategorisiert. Herr Byung-Joo Kang, vom Department of Urban and Regional Planning der Hannam University in Daejon, Ko- rea diskutiert in seinem Artikel «A Study on the Establishing Development. Model for Research Parks»[52] diese Kategorisierung. Sein praxisorientierter Artikel bietet für die Leistungsanalyse der TGZ der Schweiz im Kapitel 9 ein hilfreiches Instrument. Ein weiterer Artikel, den es im Rahmen dieser Arbeit hervorzuheben gilt, heisst «Incu- bator best practice: A framework»und stammt von Anna Bergek und Charlotte Norrman aus dem Jahre 2008[12]. Die Autorinnen beschreiben die Messproblematik von TGZ und die damit verbundene Schwierigkeit eine best practice zu formulieren. Dabei isolierten sie Kernaufgaben von TGZ, wie Selektion, Coaching und Vermittlung. Diese bieten sich ergänzend zu den Erfolgskriterien von Kang für die Leistungsanalyse der Schweizer TGZ im Kapitel 9 an. Als ein Basisartikel in der TGZ-Thematik kann «University-related Science parks - seedbeds or enclaves of innovation?»[31] von Daniel Felsenstein bezeichnet werden. Darin prüft Felsenstein die Rolle der “Science parks as ‘seedbeds’ of innovation”[31, S. 93]. Bemerkenswert ist, dass der Artikel aus dem Jahre 1994 stammt und somit zu den ältesten in dieser Arbeit verwendeten Publikationen gehört. Die erste Hälfte des Kapitels 4 dieser Arbeit stützt sich auf das Buch «Innovationen: Wirtschaft und Politik im globalen Wettbewerb»[48] von Beat Hotz-Hart, Andreas Reu- ter und Patrick Vock. Es Werk vermittelt die grundlegenden Kenntnisse zu Innovationen im wirtschaftlichen und politischen Kontext und gilt in der Schweiz diesbezüglich als Standardwerk. Es zeichnet sich durch eine Reihe von realen Beispielen aus, welche die 1 Vgl. dazu 4.9.3. 12
- 13. 3. Material und Methoden Theorie ergänzen. Die Autoren beschränken sich dabei nicht auf Beispiele aus der Schweiz und deren Innovationspolitik. Vielmehr wird eine globale Ansicht vermittelt. Ergänzende Informationen mit direktem Bezug zur Schweiz stammen aus dem Buch «Innovation Schweiz. Herausforderung für Wirtschaft und Politik«[47] welches von Beat Hotz-Hart, Barbara Good, Carsten Küchler und Andreas Reuter-Hofer verfasst wurde. 3.2. Methodisches Vorgehen Die grosse Fülle an Literatur, sowohl zu Innovationen als auch zu TGZ, erlaubte ein lineares Vorgehen. Die Stichwortsuche in den Verbunddatenbanken2 wirtschaftswissen- schaftlicher Magazine wie «The Journal of Technology Transfer», «Technovation»und «Journal of Business Venturing»führte zu einer Vielzahl an verfügbaren Publikationen. Anhand der Literaturangaben liessen sich weiterführende Artikel ausfindig machen. Die Verfügbarkeit der Artikel in elektronischer Form ist sehr hoch. Dies liegt wohl daran, dass die TGZ-Thematik sehr aktuell ist und nur wenige der relevanten Artikel vor dem Jahre 2000 publiziert wurden. Die Strukturierung der Arbeit ist entsprechend der vorgegebenen Problemstellung auf- gebaut, wobei das Kapitel 4 mit wissenschaftlichen Grundlagen zu Innovationen und zur Innovationspolitik ergänzt wurde, dies um ein möglichst umfassendes Bild der TGZ- Thematik aufzuzeigen. Auch wird damit eine Grundlage geschaffen, die es ermöglicht, im Teil IV essenzielle Rückschlüsse zu ziehen. Für den Teil IV wurde ausserdem eine Umfrage erstellt. Diese wird im Kapitel 5 präsentiert. Informationen zur Definitionsproblematik3 und der Frage nach der Finanzierung von TGZ4 gehen aus dem persönlichen E-Mail-Wechsel vom 18. und 29. August 2008 mit dem Physiker Dr. Thomas von Waldkirch aus Küsnacht (ZH), Initiant des Technoparks R Zürich und ehemaliger Leiter der Stabsstelle Forschung und Wirtschaftskontakte der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ), hervor. 2 Z.B. auf «Sciencedirect», http://www.sciencedirect.com, zuletzt besucht am 9. September 2008. 3 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.1. 4 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.10. 13
- 14. Teil II. Herleitung der Aufgabenstellung 14
- 15. 3. Material und Methoden Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Frage nach der Rolle, Funktion und Fi- nanzierung von Technologie- und Gründerzentren (TGZ). Im Teil III geht es darum, zu beschreiben, welche theoretischen Überlegungen hinter der Idee der TGZ stehen und wel- chen Nutzen diese Einrichtungen für die beteiligten Unternehmen und für die Region, in der sie situiert sind, haben. Zudem wird die Rolle der TGZ im Innovationsprozess und in der staatlichen Innovationsförderung aufgezeigt. Im Teil IV wird untersucht, ob die in der Schweiz bestehenden TGZ in der Lage sind, die im Teil III aufgezeigten Rollen und Funktionen effektiv zu übernehmen. Dazu wurde eine Auslegeordnung in Form eines Kurzporträts und einer Tabellenübersicht der konkreten Einrichtungen erstellt. Des Weiteren geht diese Arbeit der Frage nach, wie solche TGZ finanziert werden und ob staatliche Finanzhilfe geleistet werden soll. Auch werden die Geschäftsmodelle aufgezeigt. Die vorliegende Diplomarbeit soll einen Beitrag zum Verständnis der Bedeutung von TGZ bieten, eine Übersicht der TGZ-Landschaft der Schweiz aufzeigen und diese analy- sieren. Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es einer möglichst umfassenden Betrachtung der Thematik. Das Thema darf nicht auf die wirtschaftswissenschaftliche Sichtweise reduziert werden, sondern muss ergänzend aus dem Blickwinkel der Gesellschaft und der Politik betrachtet werden, da der Kontext, in den solche Zentren eingebettet sind, eine wichtige Rolle spielt. Auch die Beweggründe, die hinter der Realisation der Zentren stehen, sind wichtige Elemente der TGZ-Thematik. Dabei spielen Innovationen bzw. die Innovations- förderung eine wesentliche Rolle. Der direkte Zusammenhang von Innovation und TGZ zeigt sich bei der Definitions- und Messproblematik. Innovationen gelten als schwer greif- und definierbar. Neben der Frage, was eine Innovation überhaupt ausmacht und welche Bedingungen daran geknüpft sind, besteht die Schwierigkeit darin, den Innovationsgrad zu messen. Weder eine einheit- liche Definition noch universelle Indikatoren existieren. Dies wirkt sich entsprechend auf die TGZ-Diskussion aus. Hinzu kommt, dass auch die TGZ selbst sehr unterschiedlich definiert werden. Die Definitions- und Messproblematik wird in Abschnitt 4.1 aufgezeigt. Die Begriffe werden für die Verwendung im Rahmen dieser Arbeit im Kapitel 4 definiert. Angesichts dieser Definitions- und Messschwierigkeit stellt sich die Frage, woher der in Kapitel 1 zitierte Bill Gates die Gewissheit hat, dass Innovationen das wirtschaftliche Wachstum und somit den materiellen Wohlstand fördern. Die Antwort darauf liefert zum einen die Neue Wachstumstheorie, die in aller Deutlichkeit die Bedeutung von In- novationen zeigt[48, S. 4]. Zum anderen lässt sich diese Gewissheit auch aus historischer Sicht begründen. Der weltbekannte Ökonom Jeffrey D. Sachs zeigt in der Einführung seines Werks «Das Ende der Armut»[80] Gründe für die Entstehung des Nord-Süd-Konfliktes5 auf. Dabei führt Sachs auf, wie die USA zur Weltwirtschaftsmacht aufstiegen und erläutert, warum Afrika und andere Regionen der Erde den Aufschwung nur als Zuschauer mitverfolgen 5 Unter dem Nord-Süd-Konflikt versteht man die weltweite Polarisation eines reichen Nordens und einem armen Südens[76, S. 484]. 15
- 16. 3. Material und Methoden konnten. Als Schlüsselkriterium dieser Spaltung definiert er die Innovationstätigkeit – und nicht etwa die Ausnutzung des Südens. Der historische Abriss der Entstehung des globalen Nord-Süd-Konfliktes wird in Ab- schnitt 4.2 aufgezeigt. Der Verweis auf den historischen Kontext ist insofern themen- relevant, da die Angst, den Anschluss an die Weltwirtschaft zu verpassen, mit Afrika ein Gesicht hat und politische Argumentation für die Innovationsförderung daher ge- sellschaftstauglich ist. Dies wissen die politischen Entscheidungsträger entsprechend zu nutzen. Für die Schweiz hat die historische Rückblende eine spezielle Bedeutung. Die Schweiz geniesst den Ruf eines sehr innovativen Standorts. Die Ansicht, dass die weitgehend feh- lenden Naturressourcen wie Erdöl, Erz oder Kupfer in der Schweiz mit Know-how und entsprechender Innovationsdynamik wettgemacht werden, ist in der Gesellschaft veran- kert. Tatsächlich bietet die Schweiz eine Reihe von Muster-Innovationen mit Weltruf. Einige sind jedoch nur noch ruhmreiche Relikte aus vergangenen Zeiten. Umso mehr häufen sich Stimmen, die davor warnen, dass sich die Schweiz auf diesen verblühenden Lorbeeren ausruht[47, S. 18]. Hinzu kommt, dass Innovationen dringender denn je sind. Im Zuge der Globalisierung haben sich viele Vorgänge enorm beschleunigt. Dazu zählen insbesondere Kommunikations- und damit auch Diffusions- und Imitationsprozesse[46, S. 166]. Dies führt zu einer Verschärfung des Standortwettbewerbs. Das Projekt in Düben- dorf6 sowie eine Reihe weiterer innovationsfördernder Massnahmen können als Beweis dafür aufgeführt werden, dass die Schweiz die Thematik ernst nimmt. In Abschnitt 4.8 wird ein Blick auf die Innovationsdynamik der Schweiz geworfen. Die TGZ spielen in der Innovations- und Wachstumstheorie eine untergeordnete Rolle. Sie sind als eines von vielen innovationsfördernden Instrumenten zu verstehen[48, S. 230], wobei deren Wirkung nicht abschliessend erforscht ist. Aufgrund der fehlenden Indikatoren, aber auch wegen der Individualität solcher Zentren ist die Wissenschaft äusserst zurückhaltend mit einem Leistungsvergleich. Dasselbe gilt für die allgemeine Formulierung einer best practice, die nicht ohne weiteres von einem TGZ auf ein anderes übertragen werden kann.7 Die Frage, ob und wie sich die öffentliche Hand an TGZ beteiligen soll, wird in der Literatur entsprechend widersprüchlich diskutiert.8 Diesbezüglich ist darauf hinzuwei- sen, dass diese Frage nicht nur für solche Einrichtungen, sondern für die ganze staatliche Innovationsförderung gilt. Die Strategien der einzelnen Nationen sind dementsprechend unterschiedlich.9 Mehr Einigkeit herrscht hingegen bei der Frage nach den Innovations- treiber: Aus heutiger Sicht sind dies v.a. die Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU). Dies wird in Abschnitt 4.3 aufgezeigt. Zu den TGZ in der Schweiz existieren keine wissenschaftliche Studien. Auch werden keine quantitativen und qualitativen Daten von einer zentralen Stelle erfasst und aus- gewertet. Einige TGZ führen eigene Statistiken, jedoch mit unterschiedlichen Prioritä- ten und Indikatoren. Die Frage nach der Leistungs- und Innovationsfähigkeit ist folglich 6 Vgl. dazu Abschnitt 1. 7 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.6. 8 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.10. 9 Vgl. dazu z.B. Hotz-Hart et al., 2004[47, S. 124 ff.]. 16
- 17. 3. Material und Methoden auch aufgrund der unterschiedlichen Datenerfassung und -analyse schwierig. Diese Ar- beit versucht dennoch, die schweizerischen TGZ zu erfassen und anhand der Parameter der Erfolgsfaktoren von Byung-Joo Kang 10 und der Kernaufgaben von Bergek et al. (2008)11 vergleichend zu beurteilen. Die fehlende statistische Power schränkt jedoch die Aussagekraft der Resultate ein. Die abschliessende Frage nach der Finanzierung wird anhand pragmatischer und theo- retischer Gesichtspunkte beantwortet. 10 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.7. 11 Vgl. dazu 4.9.5. 17
- 19. 4. Definitionen und Datenlage 4.1. Innovationen Innovationen wurden in der Wirtschaftstheorie schon früh als ein wichtiger Faktor der Marktwirtschaft erkannt1. Adam Smith (1776) weist im ersten Kapitel seines Buches «Wohlstand der Nationen»[84] auf die Bedeutung von Verbesserungen des Produktions- apparates hin. Karl Marx führt in seinem Modell der kapitalistischen Wirtschaft die ständige Revolutionierung der Produktionsmittel als ein unablässiger Faktor auf, ohne den die Bourgeoisie nicht auskommt[42, S. 30]. Erst die Neue Wachstumsttheorie hat jedoch damit begonnen, sich für die Ursachen der technischen Veränderungen zu interessieren[81, S. 792]. Die Theorie, erklärt den positiven Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und Investitionen in Forschung und Entwick- lung (FuE) und operiert in den Modellen demzufolge mit endogenen Produktinnovationen [48, S. 4]. Die makroökonomische Frage wie das Wirtschaftswachstum gefördert werden kann, wurde dadurch zur Frage, wie eine Nation ihre technischen Leistungen verbessern kann[81, S. 792]. Der positive Zusammenhang von Innovationsleistung, Wirtschaftswachstum und mate- rieller Wohlfahrt wird weitgehend von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft akzeptiert. Die Diskussion um Innovationen bzw. deren Förderung wird somit in unterschiedlichen Umgebungen geführt und ist geprägt von einer Vielzahl an Anspruchsgruppen, die sich daran beteiligen[81, S. 793]. Wie in der Themeneinführung aufgezeigt, spielt die politische Ebene dabei eine besonders wichtige Rolle. Ein Grund dafür ist, dass die Innovationsför- derung oftmals die Freigabe von öffentlichen Geldern bedingt. Für Parteien von links nach rechts ist die Steigerung des Wohlstandes der Bevölkerung ein zentraler Programmpunkt. Entsprechend hoch ist der Stellenwert der Innovationsförderung. Dies zeigt sich beispielsweise im Koalitionsvertrag der aktuellen deutschen Regierung. Wie der folgende zitierte Ausschnitt veranschaulicht, setzt diese – neben den Investitionen – gezielt auf Innovationen, um das Wachstum im eigenen Land zu steigern[18, S. 22 ff.]. „Deutschland muss sich dem rasanten weltweiten Strukturwandel offensiv stel- len. Die Zeit drängt, die internationale Konkurrenz steht nicht still. Es muss schnell gehandelt werden (...). Ein halbes Prozent mehr Wachstum würde rund 2,5 Mrd. Euro mehr Steuereinnahmen und etwa 2,3 Mrd. Euro Mehr- einnahmen bei den Sozialversicherungen erbringen. Notwendig ist ein neu- er Wachstumsschub durch die Belebung von Investitionen und Innovationen (...).“ 1 Zu den vier Antriebskräften des Wirtschaftswachstums zählen: Menschliche Ressourcen, Natürliche Ressourcen, Kapitalbindung und Technischer Wandel/Innovation[81, S. 782 ff.]. 19
- 20. 4. Definitionen und Datenlage Auch auf Ebene der Europäischen Union (EU) wird dem Wachstum und den Inno- vationen als deren Förderer eine grosse Bedeutung zugestanden. Im Jahre 2000 stellte die Europäische Kommission die sogenannte Lissabon-Strategie für Wachstum und Be- schäftigung vor[75, S. 1]. Die Strategie – im Jahre 2005 neu ausgerichtet – basiert auf vier Prioritäten wobei eine den Leitspruch Mehr Investitionen in Wissen und Innovation trägt. Beide Beispiele zeigen, dass einerseits die positive Korrelation von wirtschaftlichem Wachstum und technischem Wandel als unbestritten angenommen wird und andererseits, dass der besagte Zusammenhang ohne weiteren Erklärungsbedarf kommuniziert wird[42, S. 25]. Ein Politiker, der Innovationen unterstützt, darf auf die Gunst der Wähler zählen. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Innovation? Innovation, aus den lateinischen Begriffen novus „neu“ bzw. innovatio „etwas neu Geschaffenes“, abgeleitet, ist eher als ein schwer fassbares Phänomen denn als Begriff einzustufen[30, S.1] und eine genaue Definition ist äusserst schwierig[79, S. 5]. Dies ist auf die vielseitige Verwendung des Wortes zurückzuführen. So überschneidet sich beispiels- weise die betriebswirtschaftliche Interpretation des Begriffs nicht zwingend mit derjeni- gen von Politikern oder der von Kunden, die in einem Elektronik-Fachgeschäft eine neue Digital-Kamera oder ein Mobiltelefon kaufen. Innovationen sind aber nicht nur ihrer schwierigen Definition wegen schwer erfassbar. Es fehlt auch an verbindlichen Indikatoren, um deren Grad bzw. deren Dynamik zu messen[79, S. 2]. Die Wissenschaft, die sich seit geraumer Zeit mit dem Problem beschäf- tigt, verwendet einen Kriterienkatalog, der die unterschiedlichsten Indikatoren umfasst. Deren Auswahl ist jedoch nicht einheitlich geregelt. Hinzu kommt, dass die Relevanz der gleichen Kriterien oft unterschiedlich gewertet wird. Es drängt sich dennoch zumindest der Versuch einer Definition des Begriffs, als nötige Hilfestellung für Forschung und Leh- re, Studien und Politik auf. Strategiepapiere wie jenes von Lissabon wären ohne eine genaue Begriffsdefinition von zweifelhaftem Nutzen. Eine sachliche, wenn auch sehr technische Definition ist der Innovationserhebung der Konjunkturforschungsstelle der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (KOF)[8] zu entnehmen. Wie nachfolgendes Zitat von Aventis et al., 2005[8, S. 3 ff.] zeigt, unter- scheidet die KOF zwischen Produkt- und Prozessinnovationen, wobei Produkte sowohl Güter als auch Dienstleistungen sein können. „Als Produktinnovationen gelten technisch neue oder erheblich verbesserte Produkte aus der Sicht des Unternehmens, d.h. Produkte, die hinsichtlich ihres Einsatzes, ihrer Qualität oder wegen der zu ihrer Erstellung verwendeten physischen oder interaktiven Elemente für den Nachfrager neu sind oder in ihrer Leistungsart grundlegend verbessert bzw. verändert wurden. Keine Produktneuerungen sind rein ästhetische Modifikationen von Produk- ten (z.B. Farbgebung, Styling) und Produktvariationen, z.B. aufgrund von Kundenspezifikationen, bei denen das Produkt hinsichtlich seiner technischen Grundzüge und Verwendungseigenschaften weitgehend unverändert bleibt. Prozessinnovationen beziehen sich auf den für die Unternehmung erstmaligen Einsatz technisch neuer oder erheblich verbesserter Fertigungs-/Verfahrenstechniken 20
- 21. 4. Definitionen und Datenlage zur Herstellung von Gütern bzw. zur Erbringung von Dienstleistungen an Per- sonen oder Objekten. Zwar kann sich dabei auch das Produkt ändern, doch steht die Steigerung der Effizienz im Vordergrund. Rein organisatorische Ver- änderungen werden - sofern sie nicht unmittelbar mit einer Neuerung bei Fertigungs-/Verfahrenstechniken verbunden sind - nicht zu den Prozessinno- vationen gezählt.“ Im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext wird diese Definition oft mit dem Kriterium Durchsetzung am Markt ergänzt. Dadurch wird betont, dass eine Innovation interes- sengesteuert ist und der Erfinder eigene oder vorgegebene Bedürfnisse zu befriedigen versucht[48, S. 2]. Eine neue Technik ist nach Hotz-Hart et al. (2001) nicht als eine „naturwüchsige Kraft“ zu verstehen, sondern als ein „soziales Phänomen, dessen profitable Nutzung es ökono- misch interessant macht“[48, S. 1]. Je nach sozialem Umgang, Abhängigkeiten und ge- sellschaftlicher Innovationsbereitschaft kann die gleiche Technik unterschiedliche Effekte haben[48, S. 1]. Das gesellschaftliche Umfeld und die ökonomischen, rechtlichen und kulturellen Rah- menbedingungen prägen daher die Innovationsdynamik einer Volkswirtschaft entschei- dend mit[48, S. 1].2 4.2. Die Wichtigkeit von Innovationen im historischen Kontext Bis vor rund drei Jahrhunderten gab es keine grossen Unterschiede zwischen Arm und Reich. Das Einkommensniveau war in China, Indien, Europa und Japan in etwa gleich niedrig. Marco Polo schreibt in seinen Berichten über die kostspieligen Wunder, die China zu bieten hatte. Über dessen Armut verliert er kein Wort. Ähnlich galt auch die Begeiste- rung Cortés’ den Reichtümern der Westafrikanischen Städte und nicht deren Armut[80, S. 41]. Heute ist die Berichterstattung eine andere. Die Kluft zwischen armen und reichen Ländern ist gross und wird als globales Problem wahrgenommen. In diesem Sinne stellt sich die Frage, wie es zu dieser Spaltung kam. Um etwa 1800 brach eine Ära der Wirtschaftsgeschichte an, die es seit Menschenge- denken noch nie gab. Die Bevölkerungszahl stieg rapide an und mit ihr das Pro-Kopf- Einkommen[80, S. 42].3 Dies war nur möglich, weil die Nahrungsmittelerzeugung dank technischer Neuerungen mit diesem rasanten Wachstum mithalten konnte[80, S. 46]. Vom wirtschaftlichen Wachstum waren jedoch nicht alle Regionen in gleichem Masse betroffen. Die reichen Regionen von heute machten die weit grösseren Fortschritte. Laut dem amerikanischen Ökonomen Jeffrey D. Sachs kam diese höchst ungleichmässi- ge Entwicklung aufgrund geringer Unterschiede des jährlichen Wachstums zustande[80, S. 45 ff.]. Das Bruttosozialprodukt (BSP) der USA pro Kopf der Bevölkerung beispielsweise 2 Vgl. dazu Abschnitt 4.7 3 Zwischen 1820 und 2000 in den USA um fast das Zwanzigfache, in Westeuropa um das Fünfzehnfache[80, S. 42]. 21
- 22. 4. Definitionen und Datenlage nahm zwischen 1820 und 1998 im Jahresdurchschnitt um 1,7 Prozent zu. Das hatte im selben Zeitraum eine Steigerung des Lebensstandards um das 25–fache zur Folge. Dies zeigt deutlich, dass die USA nicht wegen eines überdurchschnittlichen Wachstums zur Wirtschaftsmacht wurden, sondern vielmehr aufgrund ihrer Konstanz[80, S. 46 ff.]. Als Vergleich bietet sich der Blick auf die Entwicklung der afrikanischen Staaten im selben Zeitraum an. Das Wachstum betrug 0,7 Prozent. Der Unterschied zur amerikanischen Quote scheint nicht besonders gross, über die Jahre summiert sich dieser aber enorm. Das Pro-Kopf-Einkommen in Aftika hat sich nur um das 3–fache vergrössert[80, S. 45]. Fortführend stellt sich die Frage, warum die Raten unterschiedlich waren. Dies lässt sich gemäss Jeffrey D. Sachs hauptsächlich auf die technischen Erfindungen der reichen Länder zurückführen – und nicht etwa auf die Ausbeutung der armen Länder. Auch der Stillstand der Jahre vor dem 19. Jahrhundert findet seine Begründung im Ausbleiben von Innovationen. John Maynard Keynes schrieb 1930 in seinem bekannten Essay «Economic Possibilities for Our Grandchildren»[53, S. 358]: „Das Ausbleiben wichtiger technischer Erfindungen zwischen dem prähisto- rischen Zeitalter und der vergleichsweise neuen Zeit ist wirklich erstaunlich. Fast alles, was zu Beginn der Neuzeit wirklich eine Rolle gespielt hat, war bereits dem Menschen der Vorzeit bekannt (...)“ Mit der Entwicklung der Dampfmaschine erfolgte um 1750 in Grossbritannien der gros- se Durchbruch. Der neue Energieträger heizte im wahrsten Sinne des Wortes die wirt- schaftliche Entwicklung an. Stahl, Transporteinrichtungen, Chemikalien, Arzneimittel, Kunstdünger und vieles mehr konnten dank dem Einsatz fossiler Brennstoffe in grossen Mengen produziert werden. Der zweite Durchbruch war der Einsatz von elektrischem Strom, dessen Auswirkungen auch das Dienstleistungsgewerbe antrieb[80, S. 45]. Das Zentrum der Innovationen war damals das Vereinigte Königreich[80, S. 49]. Der historische Rückblick zeigt in aller Deutlichkeit die Wichtigkeit von Innovatio- nen auf. Nur dank diesen kann ein solides Wirtschaftswachstum erzielt und eine Region vorwärtsgebracht werden[80, S. 45]. 4.3. Wo und wie Innovationen entstehen Als Hauptakteure im Innovationsprozess gelten die Unternehmer[48, S. 5]. Josef Alois Schumpeter (1942), der sich als erster von der traditionellen statischen Sichtweise des technischen Fortschritts abwendete, betonte „die Bedeutung des Unternehmers als In- novator oder als jene Person, die neue Kombinationen in Form neuer Produkte oder Organisationsmethoden einführt“[81, S. 284]. In den 60er und 70er Jahren galt die Aufmerksamkeit diesbezüglich primär den Gross- unternehmen mit einer gewissen technologischen Vormachtstellung[48, S. 39]. Sie wurden von den Regierungen als nationale Champions gefeiert und profitierten von Vorzügen in den verschiedensten Bereichen[48, S. 212]. 22
- 23. 4. Definitionen und Datenlage Tatsächlich sind diese finanzstarken Grossunternehmen gerade in investitionsintensiven Branchen wie Chemie, Elektronik und Luftfahrt für die technologische Weiterentwicklung von Bedeutung[48, S. 39 ff.]. Mit der Förderung bzw. Bevorzugung dieser Unternehmen nimmt der Staat jedoch Einfluss auf die Innovationsschwerpunkte und läuft damit Gefahr am Markt vorbei zur fördern. Ein prominentes Beispiel einer solchen falschen staatlichen Technologieauswahl, ist das misslungene deutsche Milliarden-Projekt «Transrapid»[85, S. 182]. Auch vom strukturellen Aspekt her ist eine alleinige Förderung der Grossunternehmen zweifelhaft, da empirisch kein Zusammenhang zwischen technischem Fortschritt und ab- soluter Unternehmensgrösse nachgewiesen werden konnte[48, S. 26]. Hingegen kann sta- tistisch belegt werden, dass der volkswirtschaftlich grösste Anteil an Innovationen nicht in den Laboratorien der Grossunternehmen entsteht, sondern bei Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU)[48, S. 29]. Der Trend der Grossunternehmen zur Aufspaltung ihrer Organisation in kleinere selbstständige Einheiten kann als Indiz dieser These interpretiert werden. Die Multinationalen Unternehmen (MNU) wollen dadurch ihre Innovationstä- tigkeit und ihre Gewinne steigern[48, S. 29 ff.]. In der zeitgenössischen Innovationspolitik wird daher den Unternehmensgründungen grosse Bedeutung in der Innovationsdynamik zugesprochen[24, S. 1103]. Dabei sind v.a. sogenannte Start-ups gemeint. Das sind technologiebasierte Jungunternehmen. Gehen diese aus dem Wissenschafts- und Forschungssystem hervor, werden sie als Spin-offs bezeichnet[47, S. 63]. Beobachtungen von Start-ups aus den USA zeigen, dass deren positive Effekte sich nicht nur auf die Beschäftigung auswirken können, sondern sie verhelfen der heimischen Wirtschaft zusätzlich zu einer Dynamisierung. Wissenschaftlich ist der konkrete Nut- zen von Start-ups jedoch schwer nachzuweisen bzw. zu messen. Dies einerseits wegen der Schwierigkeit Innovationen zu erfassen und andererseits, weil Daten aufgrund un- terschiedlicher Begriffsdefinitionen nicht miteinander verglichen werden können[47, S. 63 ff.]. Es gibt dennoch Beispiele, an denen die Bedeutung von Start-ups hinsichtlich des Bei- trags zur Innovationsdynamik deutlich aufgezeigt werden kann. So haben beispielsweise in der Pharmaindustrie die Start-ups die Zentrallabors ersetzt und für die Innovations- dynamik von Silicon Valley sind ebenfalls weitgehend die technologiebasierten Jungun- ternehmen verantwortlich[47, S. 63]. Bei der Entstehung von Innovationen nehmen Kooperationen und Netzwerke einen ho- hen Stellenwert ein. Es konnte anhand von Studien bewiesen werden, dass eine vernetzte Organisationsform einem Alleingang überlegen ist. Dies gilt sowohl für den Innovations- grad, das Umsatzwachstum sowie für den Gewinn[47, S. 22]. Der Grund dafür ist, dass für den Erfolg einer Innovation sowohl unternehmerische und technologische als auch organisatorische Fähigkeiten optimal zusammenspielen müssen. Die Wissensgenerierung allein reicht nicht aus[47, S. 21]. Um beispielsweise die Risiken bei der Produktentwicklungen zu minimieren und die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, suchen sich die Unternehmen starke Partner. Diese finden sie in Hochschulen, privaten Forschungsinstituten und anderen Unternehmen[47, S. 58 ff.]. 23
- 24. 4. Definitionen und Datenlage Netzwerke und Partnerschaften sind auch für die Schweizer Wirtschaft die gängige Form der Wissensfindung und -anwendung. Über die Hälfte der innovativen Unternehmen arbeitet mit externen Partnern4 zusammen. Dies zeigt, dass die Innovationstätigkeit tendenziell nicht nur von den Fähigkeiten einzelner Unternehmen und Menschen abhängt. Vielmehr spielt das Zusammenwirken der Akteure eine entscheidende Rolle[47, S. 59]. Die Förderung eines leistungsfähigen nationalen Innovations- und Technologienetzwer- kes ist aus volkswirtschaftlicher Sicht daher ein wichtiger Bestandteil der Innovationspo- litik [47, S. 59]. 4.4. Definition und Bedeutung von Wissensspillover-Effekten Im Zusammenhang mit der Frage der Entstehung von Innovationen spielen sogenann- te Wissensspillover-Effekte eine wichtige Rolle. Damit sind Externalitäten gemeint, bei denen technische und wissenschaftliche Informationen den Charakter eines öffentlichen Gutes haben[41, S. 84]. Die Wissensspillover-Theorie operiert dabei mit den beiden Variablen Zeit und Raum und besagt, dass die Wirkung der Externalitäten und die Wissensdiffusion nicht gleich- mässig verlaufen sondern von regionalen Mustern stark beeinflusst werden[41, S. 86]. Der Transfer von neuem Wissen in beispielsweise Produktionseinrichtungen erfolgt da- her unterschiedlich. Dies kann wiederum regional zu unterschiedlichem Produktions- und Einkommenswachstum führen[41, S. 86]. Bei Wissensspillover-Effekten wird von einer raumgebundenen Wirkung ausgegangen und die Externalitäten stehen nur innerhalb ge- wisser Distanzen als öffentliches Gut zur Verfügung. Nicht nur bei den Wissensflüssen in technologisch besonders fortschrittlichen Sektoren spielen Wissensspillover-Effekte eine wichtige Rolle. Sie können auch für die Produk- tivität eines Arbeiters von Bedeutung sein, z.B. wenn dieser durch Nachahmung oder sogenanntes Learning-on-the-Job Fähigkeiten erwirbt und ausbaut. Auch in diesem Fall ist eine räumliche Gebundenheit offensichtlich[41, S. 84]. Für die regional gebundene Verfügbarkeit von Wissen existieren zahlreiche Begründun- gen. Diese hängen primär mit den Transfermechanismen und -möglichkeiten zusammen[41, S. 86]. Wissensspillover-Effekte sind bis heute nicht quantifizierbar[74, S. 562]. 4.5. Definition und Bedeutung des Wissenstransfers Im Wissenstransfer unterscheidet man zwei Akteure: Den Erfinder (Innovator) und den Nutzer. Der Innovator kann ein Unternehmen mit einem technologischen Schwerpunkt, ein Forscher, Entdecker, Designer, ein Besitzer von Patenten etc. sein. Der Kunde ist 4 Dazu zählen: Kunden, Zulieferer, potenzielle und tatsächliche Konkurrenten, Bildungseinrichtungen der Sekundär- und Tertiärstufe, FuE-Laboratorien sowie der Staat und seine innovationspolitischen Förderorganisationen[47, S. 21]. 24
- 25. 4. Definitionen und Datenlage oftmals eine kommerzielle Firma. Sie bringt die neuen Produkte und Dienstleistungen auf den Markt[41, S. 86]. Beim Wissenstransfer geht es darum, den Graben zwischen den beiden Akteuren zu überwinden, indem die optimalen Partner miteinander in Kontakt gebracht werden und ein entsprechender Zusammenarbeitsvertrag erstellt wird[33, S. 95]. Je nach Wissensform kann das äusserst schwierig sein. Dies gilt insbesondere für neu gewonnene Einsichten, die sprachlich nur schwierig darstellbar und kodifizierbar sind. Auch das Kommunika- tionsverhalten des Wissensinhabers hat einen entscheidenden Einfluss auf den Transfer des Wissens. Die Dimension Raum ist dabei eine wichtige Komponente, da einerseits die räumliche Nähe die informelle Kommunikation zwischen Wissensträgern vereinfacht und andererseits, weil der Wissensträger aufgrund von Transaktionskosten-Überlegungen eine regional begrenzte Kooperationsform einer räumlich unbegrenzten Form vorziehen wird[41, S. 86]. 4.6. Definition und Bedeutung von Agglomerationseffekten Der Begriff Agglomerationseffekt ist in der Industriestandortlehre und in der Raumwirt- schaftstheorie von grosser Bedeutung[1]. Im Zusammenhang mit TGZ spielen v.a. die positiven Agglomerationseffekte eine Rolle. Dies sind Kostenersparnisse, die aufgrund der räumlichen Ballung zustande kommen. Sie werden weiter unterteilt in interne und externe positive Agglomerationseffekte. Interne Ersparnisse resultieren aus der innerbe- trieblichen Konzentration an einem Standort. Die Kostenvorteile gehen aufgrund soge- nannter Skaleneffekte, innerbetriebliche Verbunde sowie Optimierung der Organisation zurück[1]. Bei den externen positiven Skaleneffekten ergeben sich die Kostenvorteile durch räum- liche Nähe zu anderen Betrieben, Infrastruktureinrichtungen, Informationsquellen und zum Arbeits- und Absatzmarkt. Die externen positiven Agglomerationsvorteile werden unterteilt und zwar in Lokalisations- und Urbanisationsvorteile. Erstere sind Erspar- nisse, die aufgrund der räumlichen Konzentration von branchengleichen Betrieben und somit der gemeinsamen Nutzung spezifischer Arbeitsmärkte, Zulieferbetriebe oder For- schungseinrichtungen wegen entstehen. Die Urbanisationsvorteile sind allgemeine Ver- städterungsvorteile, die aufgrund der Marktgrösse und der Infrastruktur-Ausstattung entstehen[1]. Agglomerationsnachteile bzw. negative Agglomerationseffekte sind beispielsweise Ver- kehrsstau, Umweltverschmutzung etc. Diese Kosten schlagen sich nur bedingt in der betrieblichen Kostenrechnung nieder[1]. 4.7. Das Nationale Innovationssystem (NIS) Wie in Abschnitt 4.3 aufgezeigt, geht der technologische Fortschritt auf eine Vielzahl verschiedener Akteure zurück. Dabei handelt es sich nicht nur um Innovatoren oder bestimmte Nutzer. Auch Wettbewerbsrecht, Offenheit der Märkte, Regulierungen und 25
- 26. 4. Definitionen und Datenlage Abbildung 4.1: Modell eines Nationalen Innovationssystems nach Arnold und Kuhlmann, 2001[55, S. 2]. daraus folgende administrative Belastungen und Abgabenlasten beeinflussen die Innova- tionen bzw. die Innovationsdynamik entscheidend mit. Betrachtet man dieses Netzwerk als ein makroökonomisches System, spricht man von einem sogenannten Nationalen In- novationssystem (NIS)[47, S. 27]. Nach internationalem Verständnis ist ein Nationales Innovationssystem „die Kulturlandschaft all jener Institutionen, die wissenschaftlich for- schen, Wissen akkumulieren und vermitteln, die Arbeitskräfte ausbilden, Technologie entwickeln, die innovative Produkte und Verfahren hervorbringen sowie verbreiten; hier- zu gehören auch einschlägige regulative Regimes (Standards, Normen, Recht) sowie die staatlichen Investitionen in entsprechende Infrastrukturen“.[36, S. 99 ff.] Anhand dieser Definition wird deutlich, dass der technologische Fortschritt in einem NIS ein kulturell geprägter Begriff ist. Das System entwickelt sich über viele Jahre und ist entsprechend pfadabhängig. Folglich gibt es keine theoretischen und empirischen Re- ferenzgrössen, anhand derer ein optimales Innovationssystem definiert werden kann[48, S. 150ff]. Auch verhindert diese Pfadabhängigkeit eine radikale Umorientierung innerhalb kurzer Zeit. Es ist auch kaum sinnvoll vorhandenes, traditionsreiches technisches und betrieb- liches Know-how durch etwas grundsätzlich Neuartiges zu ersetzen. Vielmehr muss sich eine Region bzw. eine Nation bei der Suche nach neuen Geschäftsfeldern sowie neuen Anwendungs- und Umsetzungsmöglichkeiten darum bemühen, dass sie dort ihre bereits vorhandenen Stärken effizient einsetzen kann[48, S. 299]. Die Schweiz ist in ihrem historisch gewachsenen Netz v.a. in den kontinentaleuropäi- schen Industriestaaten verankert, was auf geografische Gründe zurückzuführen ist[48, S. 287]. 26
- 27. 4. Definitionen und Datenlage Die Abbildung 4.1 zeigt die Akteure eines Nationalen Innovationssystems schematisch auf[55, S. 2]. 4.8. Die Innovationstätigkeit der Schweiz Die Innovationstätigkeit ist für die Schweiz von besonderer Bedeutung für das Wirt- schaftswachstum, da das Niveau der geleisteten Arbeitsstunden bereits sehr hoch liegt und die für das Wachstum nötige Steigerung der Arbeitsproduktivität nur anhand neuer Technologien möglich ist[47, S. 19 ff.]. Dabei blickt die Schweiz auf eine lange Tradition hoher Innovationstätigkeit zurück. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Unternehmen und Institutionen immer wieder gute Ideen hervorgebracht. Die daraus entwickelten innovativen Produkte und Dienstlei- tungen wurden auf der ganzen Welt erfolgreich abgesetzt[47, S. 18]. Der folgende Auszug aus der Schriftenreihe «Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik»des Vereins für Wirtschaftshistorische Studien präsentiert einige prominente Beispiele:5 1867 erfand Henri Nestlé das Kindermehl (Milchpulver). Eine weitere Innova- tion im Bereich der Lebensmittel gelang Julius Maggi 1886 mit der Herstel- lung von Beutel-Suppe. Das weltweit bekannte Armee-Taschenmesser wurde 1897 von Karl Elsener patentiert. Das Unternehmen Alusuisse stellte 1912 die dünne Alufolie vor. Martin Othmar Winterhalter entwickelte 1923 den Reissverschluss Riri. 1938 erfand Max Morgenthaler den Nescafé. Auch im Bereich der Informatik ist die Schweiz mit Pionierleistungen vertreten: 1968 erfand Niklaus Wirth die Programmiersprache Pascal und 1981 entwickelten Jean Daniel Nicoud und Daniel Porel die Computermaus Logitech. Hinzu kommen bahnbrechende Medikamente, Gründungen von Institutionen mit Weltruf und wissenschaftliche Erkenntnisse mit nachhaltigen Auswirkun- gen. Nach einer leichten Abschwächung um die Jahrtausendwende6 ist die Schweiz zurück an der Spitze und weist gemäss der neusten Studie der Konjunkturforschungsstelle der Eid- genössischen Technischen Hochschule Zürich (KOF) zwischen 2003 und 2005 eine stabile Innovationstätigkeit auf[54]. Der Vorsprung der Schweizer Firmen auf ihre Konkurrenten, insbesondere jenen aus Deutschland und Skandinavien, verkleinerte sich jedoch[54]. Im Global Competitiveness Index 2007–2008[96] konnte die Schweiz den Spitzenplatz aus dem Vorjahr nicht mehr halten und rangiert neu auf Rang zwei. Dies sowohl in der Gesamtwertung als auch in der Kategorie «Innovationen». Ebenfalls auf Rang zwei ist die Schweiz im Europäischen Innovationsindex 2005[70, S. 10], welcher sich aus 25 Indikatoren zusammensetzt und v.a. Innovationstreiber, Wissensgenerierung, Innovation und Entrepreneuership sowie die Anwendung geistigen Eigentums berücksichtigt. 5 Eine chronologische Zusammenstellung ist auf http://www.muellerscience.com/SPEZIALITAETEN/ Schweiz/Beruehmte_Schweizer.htm abrufbar, zuletzt besucht am 3. September 2008. 6 Vgl. dazu z.B. der «International Benchmark Report 2002»des Basler Wirtschaftsforschungsinstitutes BAK Basel Economic[10, Part B, S. 44 ff.]. 27
- 28. 4. Definitionen und Datenlage Bei der Interpretation solcher Studien gilt es zu beachten, dass die empirische Erfassung von Innovationen bzw. der Innovationstätigkeit sehr schwierig ist.7 Jeder Indikator ist mit Messfehlern behaftet und berücksichtigt nur Teilaspekte des Innovationsverhaltens. Zudem verfolgen die Unternehmen je nach wirtschaftlichem Umfeld (Branchenzugehörig- keit, Konkurrenzverhältnisse etc.) unterschiedliche Innovationsstrategien[9, S. 21]. Dies äussert sich z.B. beim oft verwendeten Indikator der quantitativen Patentanmeldungen. Dieser ist für den Dienstleistungssektor irrelevant, da Innovationen dieser Branche nicht patentiert werden können. Auch haben gewisse Studien eine schwache wissenschaftliche Grundlage und basieren teilweise sogar auf Einzelbeobachtungen[9, S. 9]. Die Daten sind daher im besten Fall als eine Approximation des Innovationserfolges zu verstehen[48, S. 24]. In der Zukunft muss die Schweiz ihre Standortattraktivität und das Wohlstandsniveau hoch halten. Dabei muss sie sich am Innovationswettbewerb ausrichten und die dafür notwendige Dynamik und Aggressivität aufbringen[47, S. 19] sowie eine gezielte Stra- tegie verfolgen. Die Förderung der Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU), die als «Quellen»von Innovationen gelten, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Aktuell machen diese gemäss der Studie der Konjunkturforschungsstelle der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (KOF) eine sehr gute Figur. Die Schweiz hält diesbezüglich im inter- nationalen Vergleich den ersten Rang[54]. 4.9. Technologie- und Gründerzentren (TGZ) 4.9.1. Definition In der englischsprachigen Literatur findet man im Zusammenhang mit Zentren, die das Jungunternehmertum und den Wissenstransfer fördern, eine Reihe unterschiedlicher Be- griffe ([14, S. 268 ff.], [39, S. 59]). Dies ist problematisch, da es anhand der variierenden Begriffe schwierig ist, ein Verzeichnis der Anlagen zu erstellen. Systematische Forschungs- arbeit ist jedoch auf eine solche Information angewiesen[39, S. 59]. Auch aus Sicht der Betreiber der Zentren besteht der Drang, die Unterscheidung der TGZ-Typen so klar wie möglich zu machen. Nur so kann über Synergiemöglichkeiten und Konkurrenzsituationen entschieden werden8. In der englischen Literatur scheint sich zum Begriff «Incubator»eine Einigung abzu- zeichnen. Im Rahmen dieser Arbeit wird dieser Begriff mit «Gründerzentrum»übersetzt. Dabei gilt es zu betonen, dass in der deutschsprachigen Literatur u.a. auch der Begriff «Inkubatoren«Verwendung findet. Es drängt sich jedoch für diese Arbeit eine, wenn auch sprachlich nicht ganz korrekte, Übersetzung auf. Gründerzentren können nach Peters (2004) als „eine unterstützende Umgebung für Start-ups und Jungunternehmen, die Arbeitsplätze schafft, das Wirtschaftswachstum und den Technologietransfer fördert“ beschrieben werden[71, S. 83]. 7 Vgl. dazu Abschnitt 4.1. 8 Diese Information stammt aus dem E-Mail-Wechsel mit Dr. Thomas von Waldkirch aus Küsnacht (ZH) vom 18. August 2008. 28
- 29. 4. Definitionen und Datenlage In der Wissenschaft hat sich die Definition des Begriffs Gründerzentren anhand von vier Angebotsleistungen durchgesetzt[12, S. 21]: • gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, die zu mehr oder weniger angemessenen Prei- sen vermietet werden • verschiedene Dienstleistungen, die gemeinsam genutzt werden, um Kosten zu sparen • Professionelles Coaching • Aufbau, Pflege und Vermittlung eines internen und externen Netzwerkes In der Literatur werden die einzelnen Angebote unterschiedlich gewertet. Auch sind Veränderungen in deren Gewichtung über die Zeit zu beobachten. Während zu Beginn der Forschung die Vermietung von Anlagen und das Anbieten administrativer Dienstleis- tungen als Kernaufgaben von Gründerzentren definiert wurden, hat in jüngster Zeit der Business-Support an Bedeutung gewonnen[71, S. 88]. Diese Verlagerung der Kernkompetenzen ist gemäss Anna Bergek et al. (2008) zu begrüssen, da sich dadurch das Gründerzentrum klarer von einem Hotel unterscheiden lässt[12, S. 21]. Die Vermietung von Räumlichkeiten und Anlagen ist dennoch zentraler Bestandteil des Konzeptes eines Gründerzentrums. Neben den kostenrelevanten Vorteilen begünstigt die gemeinsame Nutzung von Anlagen und Ressourcen den Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch zwischen den im Zentrum angesiedelten Unternehmen[12, S. 21]. Abgesehen von den aufgezählten vier Basisangeboten, anhand deren Gründerzentren grob definiert werden können, gibt es keinen weiteren gemeinsamen Nenner[12, S. 21]. Unterschiedliche Auffassungen bestehen beispielsweise darin, ob ein Gründerzentrum eher als eine Organisation oder als eine räumliche Umgebung für Unternehmen einzustufen ist[72, S. 168]. Auch die Wachstumsphase, in der sich die Mieter in einem Gründerzentrum befinden, ist mangels Einstimmigkeit in der Literatur nicht definierbar. Einige Wissenschaftler setzen diesbezüglich Gründerzentren den Technologie- und Wissenschaftsparks gleich, andere unterscheiden die Begriffe je nach Entwicklungsphase der Unternehmen[12, S. 21]. Eine überwiegende Anzahl von Forschern ist der Ansicht, dass Gründerzentren primär für Unternehmen konzipiert sind, die sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden.9 Diese Unternehmen haben eine Geschäftsidee, welche jedoch noch nicht ganz ausgereift ist. Auch der Businessplan ist noch nicht vollständig entwickelt. Die Gründerzentren hel- fen diesen Firmen, lebensfähige Unternehmen zu werden[35, S. 115]. Diese Ansicht ist kompatibel mit der Definition von Brooks (1986), welcher Gründungszentren als Brücke zwischen neuen Ideen und dem Versuchsstadium beschreibt[16, S. 24]. In diesem Sinne sollte der Begriff nicht im Zusammenhang mit Zentren und Parks verwendet werden, die etablierte Unternehmen unterstützen[12, S. 22]. Anna Bergek et al. (2008) beschreiben Letztere als Wissenschafts- und Technologieparks[12, S. 22]. Dies entspricht auch der 9 Vgl. dazu z.B. Grimaldi (2005)[35]. 29
- 30. 4. Definitionen und Datenlage Abgrenzung nach Thomas von Waldkirch,10 der die wissenschaftliche TGZ-Diskussion der Schweiz entscheidend prägt. Er unterscheidet zwischen Gründerzentren, Technologie- parks und Science-Parks. Das Markenzeichen von Gründungszentren ist gemäss seinen Aussagen die «Förderung des Sich-Selbstständig-Machens». Mieter sind Dienstleister, Gewerbebetriebe, Kunstschaffende und Technologiefirmen. Science-Parks zeichnen sich durch die Ansiedlung von Technologiefirmen aus. Eingemietet sind demnach primär be- stehende und grössere Technologiefirmen, Dienstleister und Gewerbebetriebe. Die Nähe zu Hochschulen ist als Attraktion nötig. Technologieparks hingegen fokussieren auf den Technologietransfer und die Innovation. Die Mieterschaft besteht aus neuen und beste- henden Technologiefirmen, Dienstleistern und Gewerbebetrieben. Der direkte Kontakt zu Hochschulen und Fachhochschulen ist gewünscht. Diese Definition wird im Rahmen dieser Arbeit für den Begriff Technologiezentren übernommen. In der Schweiz fällt im Zusammenhang mit TGZ vereinzelt der Begriff «Technopark». Dieser wurde im Jahre 1995 als Marke beim Eidgenössischen Amt für Eigentum unter der Registrationsnummer P-429338 eingetragen. Besitzer der Marke ist die Technopark R Immobilien AG[89]. Im Abschnitt Waren und Dienstleistungen der Eintragung ist eine ausführliche Beschreibung der Marke aufgeführt. Diese reicht von der Organisation und Führung von Unternehmen, Jungunternehmerförderung über Immobilienhandel, Bauma- nagement bis hin zur Organisation von Symposien und Seminaren. Der Markenschutz gilt nur innerhalb der Schweiz. In der englisch sprachigen Literatur trifft man dennoch selten auf den Begriff Technopark. Es bleibt die Definition der Wortkombination Technologie- und Gründerzentrum (TGZ). Innerhalb dieser Arbeit steht TGZ als Überbegriff aller innovationsfördernden Anlagen und Umgebungen. Diese Auslegung schliesst insbesondere die aufgeführte Definition des Begriffs Gründerzentrum anhand der vier Angebotsleistungen sowie die Definition von Technologieparks von Thomas von Waldkirch ein. Bezüglich der in einem TGZ eingemie- teten Unternehmen gilt es zu betonen, dass diese primär im Hightech-Bereich tätig sind. Ihr Alter bzw. ihre Entwicklungsstufe ist nicht relevant. Die Definition von TGZ als ein Überbegriff verlangt nach einer Auflistung der diesem Begriff untergeordneten Elemente. Eine endgültige Auslegung ist jedoch nicht möglich. Die Literatur ist uneinheitlich und es entstehen immer wieder neue Namen. Hinzu kommt, dass gewisse Ausdrücke nur sehr ungenau in die deutsche Sprache übersetzt werden kön- nen (z.B. Incubators, seedbeds u.a.). Es gibt dennoch Ansätze, die unterschiedlichen Klassen von TGZ zu beschreiben. Ein solcher stammt von der Regierung Südkoreas. Die Beweggründe dafür sind auf das staatli- che Innovationsförderungsprogramm zurückzuführen. Die südkoreanische Regierung hat zusammen mit dem Internationalen Währungsfond (IWF) die TGZ im eigenen Land sehr stark und gezielt unterstützt.11 Für diese Förderung erstellte die zuständige Behör- de sechs Kategorien. Entsprechend der Einteilung eines TGZ wurden die Subventionen vergeben[52, S. 204]. Byung-Joo Kang von der Hannam University in Daejon kritisierte 10 Diese folgenden Informationen stammt aus dem E-Mail-Wechsel mit Dr. Thomas von Waldkirch aus Küsnacht (ZH) vom 18. August 2008. 11 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.9. 30
- 31. 4. Definitionen und Datenlage die damalige Kategorisierung als zu wenig wissenschaftlich fundiert[52, S. 203]. Er arbei- tete ein neues Raster aus und ordnete jeder Klasse ein TGZ-Beispiel zu[52, S. 204]. Die Klassifizierung ermöglicht je nach räumlicher Dimension sowie Zielsetzung und Funktion eine Abgrenzung der verschiedenen TGZ-Typen. Im Folgenden wird die Einteilung nach Kang aufgezeigt. 4.9.2. Klassifizierung von TGZ nach Kang Klassifizierung nach der physikalischen Erscheinung Hier werden nach Byung-Joo Kang[52, S. 204] drei Typen unterschieden: • kompakte Anlagen • verstreute Anlagen • gruppierte Anlagen12 Kompakte TGZ konzentrieren sich auf ein paar Gebäude oder ein kleines Gebiet. Dies er- möglicht einen einfachen und effektiven Informationsaustausch innerhalb des Zentrums. Diese Eigenschaft wird dem Austausch- und Kontaktbedürfnis der Forscher gerecht. Die Management-Kosten eines solchen TGZ sind verhältnismässig niedrig. Das Konfliktpo- tenzial zwischen den Mietern ist bei einer Ansiedlung von FuE und Produktion an ein und demselben Platz jedoch hoch, was ein entscheidender Nachteil dieses Konzeptes ist. Kompakte TGZ werden v.a. in wirtschaftlichen Ballungszentren gegründet. Ein Beispiel dafür sind die Research Parks in New York[52, S. 205]. Bei grossen und langfristigen Projekten ist es aufgrund des erwähnten Konfliktpoten- zials kompakter Zentren optimaler, ein verstreutes TGZ zu initiieren. Die Anlagen und Einrichtungen sind auf mehrere Gebäude verteilt. Diese verstreute Anordnung führt zu einem Anstieg der Management-Kosten und einem Effizienzverlust im Informationsaus- tausch. Gruppierte TGZ sind ein Mix von verstreuten und kompakten Anlagen, d.h. im TGZ sind in sich kompakte Anlagen verstreut angeordnet. Für diese Klasse spricht, dass der Gesamtnutzen durch die Ansiedlung von kleinen Firmen und Forschungseinrichtungen mit ähnlichen Schwerpunkten am gleichen Ort innerhalb des Zentrums gesteigert werden kann. Die Anordnung verschafft dem TGZ eine gewisse Exklusivität und wird attraktiv. Für Byung-Joo Kang steht diese Klassifizierung für Research Parks im Allgemeinen[52, S. 205]. Klassifizierung nach der Grösse Entsprechend der räumlichen Grösse unterscheidet Byung-Joo Kang drei Typen[52, S. 204]: • kleine Anlagen, die sich auf ein Gebäude konzentrieren 12 Byung-Joo Kang beschreibt diese Klasse als mixed. 31
- 32. 4. Definitionen und Datenlage • grosse Anlagen, die sich über ein weites Gelände erstrecken • sogannte Technopolis-Parks, die mit kleinen Städten verglichen werden können Bei hohen Land- und Mietpreisen sind Zentren, die sich auf ein zentrales Gebäude konzentrieren aus Kostengründen am sinnvollsten. Die Hauptmieterschaft dieser Anlagen sind kleine Start-ups und Venture-Unternehmen, die für ihre Tätigkeiten wenig Platz benötigen. Wiederum führt Byung-Joo Kang als Beispiel die Research Parks in New York auf[52, S. 205]. In grossen TGZ wie z.B. dem Kumamoto Techno Research Park in Japan, die sich über ein weites Gelände erstrecken, belegen die einzelnen Unternehmen ein eigenes Gebäude, das im Idealfall auf die Mieterschaft zugeschnitten ist. Diese TGZ-Typen benötigen ein gut funktionierendes Management-Center, welches den über das weite Gelände verteil- ten Mietern verschiedene Dienstleistungen anbietet und etwaige Konflikte zwischen den Unternehmen schlichtet[52, S. 204]. Technopolis-Parks führen Bildung, Kultur, Forschung und Business-Institutionen zu- sammen. Verständlicherweise wird dafür ein sehr grosses Grundstück benötigt. Entspre- chend gross ist der für die Realisation nötige finanzielle Aufwand. Die Umwandlung eines bestehenden Parks (z.B. eines Industrieparks) kann den Aufwand und die Kosten erheblich reduzieren[52, S. 204]. Die Tsukuba Science City in Japan ist ein Beispiel eines solchen TGZ[52, S. 205]. Klassifizierung nach Zielsetzung und Funktion Byung-Joo Kang definiert fünf unterschiedliche Zielsetzungen und Funktionen, die TGZ verfolgen[52, S. 204 ff.]: • Forschung und Entwicklung FuE • Entwicklung technologischer Innovationen • Entwicklung von Basis-Technologie • industrielle Umstrukturierung • mehrere Ziele gleichzeitig In den FuE-lastigen TGZ hat die Forschung und Entwicklung (FuE) erste Priorität. Fabrikationsbetriebe sind entsprechend in der Minderheit. An dieser Zielsetzung wird kritisiert, dass die regionale Entwicklung nur wenig profitiert[52, S. 204]. Byung-Joo Kang zählt den Surrey Research Park aus Guildford (UK) zu dieser Klasse[52, S. 205]. TGZ mit dem Schwerpunkt in der Entwicklung von technologischen Innovationen sind verhältnismässig klein. Das Ziel dieser Zentren ist es, den Start-ups und den etablierten Firmen einen Innovationsschub zu geben und neue Arbeitsplätze zu schaffen[52, S. 204]. TGZ, deren Fokus die Entwicklung von Basis-Technologien ist, werden in Regionen gegründet, die sich wirtschaftlich nur zögerlich entwickeln, aber prominente technische 32
- 33. 4. Definitionen und Datenlage Hochschulen und Universitäten besitzen. Das Ziel dieser Zentren ist es, eine regiona- le Technologiegrundlage zu etablieren, indem sie Forschungsinstitutionen anziehen bzw. schaffen[52, S. 204]. Der Research Park in Kanakawa (J) ist ein Beispiel dafür[52, S. 205]. Der Hsinchu Industrial Park in China wurde gebaut, um die industrielle Umstruk- turierung herbeizuführen. Dies geschieht durch ein aktives Anwerben von Hightech- Unternehmen als Mieter[52, S. 204]. TGZ wie die Tsukuba Science City verfolgen mehrere Ziele[52, S. 205]. Sie sind ver- gleichbar mit kleinen Städten und bieten den Wissenschaftlern und deren Familien mit Ausbildungseinrichtungen, Wohnungen, kulturellen Angeboten etc. ein vielfältiges Ange- bot. Diese Zentren sind in der Nähe grosser Städte angesiedelt[52, S. 204]. Der Innovati- onspark Dübendorf ist m.E. in dieser Klasse einzuordnen. Klassifizierung nach dem Management-Typ Beim Management eines TGZ unterscheidet Byung-Joo Kang fünf Typen[52, S. 205 ff.]: • Universitäten • Regierungen (national, lokal) • Partnerschaften13 • Entwickler • Non-Profit-Organisationen (NPO) TGZ unter der Leitung einer Universität oder Hochschule werden gegründet, um die Forschungsresultate zu kommerzialisieren. Dadurch wird versucht, einen Beitrag zur re- gionalen Wirtschaftsförderung zu leisten. Diese TGZ zeichnen sich aufgrund der finan- ziellen Einschränkungen durch verhältnismässig kleine Flächen aus. Sie sind oftmals auf FuE oder auf die Entwicklung technologischer Innovationen ausgerichtet[52, S. 205]. Ein prominentes Beispiel dieser Klasse ist der Cambridge Science-Park[52, S. 206]. TGZ unter staatlichem Management sind eher auf grossen Flächen angesiedelt. Das Ziel dieser Zentren ist es, der Region im nationalen Innovationswettbewerb Vorteile zu verschaffen. Die Entwicklungsfortschritte solcher Anlagen sind bereits nach einer kurzen Zeitperiode sichtbar. Es findet wenig Kooperation zwischen den regionalen Forschungs- instituten und Industrien statt[52, S. 205]. Zu dieser TGZ-Klasse zählt Sophia Antipolis in Antibes, Frankreich[52, S. 206]. TGZ unter dem Management einer lokalen Behörde werden gegründet, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Dies geschieht mit der Förderung von kleinen Start-ups sowie mit der Innovationentätigkeit bestehender Unternehmen[52, S. 206]. Partnerschafts-TGZ werden von Stiftungen geführt und von der lokalen Regierung, Universitäten und Privatunternehmen gestützt. Die Beiträge der Universitäten liegen in den Bereichen Forschung, Personal und Anlagen. Die lokale Regierung stellt das Land 13 Engl.: Joint partnership 33
- 34. 4. Definitionen und Datenlage zur Verfügung und die Privatunternehmen steuern ihren Teil mit dem Gebäudebau und der Entwicklung des Geländes bei[52, S. 206]. Ein grosser Teil der japanischen TGZ zählt zu dieser Klasse[52, S. 206]. Zu einem weiteren TGZ-Typ zählen Zentren, die von den Entwicklern selbst gegründet werden. Diese sind um Metropolen wie New York und Tokio herum angesiedelt. Der Landpreis ist entsprechend hoch. Das Gelände und die Anlagen werden aufgeteilt und vermietet bzw. verkauft[52, S. 206]. Non-Profit-Organisationen NPO sind an der regionalen Entwicklung interessiert und wollen mit den TGZ unter ihrem Management die regionale Wirtschaft beleben. Die Miet- preise in diesen Zentren sind angemessen, was eine entsprechende Nachfrage generiert[52, S. 206]. 4.9.3. Verbreitung Das erste Gründerzentrum war das Batavia Industrial Center in Batavia, New York. Es wurde im Jahre 1959 eröffnet. Das rund 80’000 Quadratmeter grosse Gelände stand nach dem Auszug einer grossen Firma leer. Ein Nachmieter für das ganze Gebäude war schwer zu finden, daher unterteilte der Besitzer die Räumlichkeiten und vermietete sie unter- schiedlichen Unternehmen. Bei einigen bestand die Nachfrage nach Business-Ratschlägen und Hilfe bei der Kapitalsuche[39, S. 57]. In den 1960er und 1970er Jahren verbreitete sich die Gründerzentrums-Idee nur lang- sam. Die meisten Anlagen wurden in urbanen Zonen erstellt mit dem Ziel, die dortige wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln. Das in den 1970er Jahren ins Leben gerufe- ne National Science Foundation’s Innovations Centers Program verschaffte dem TGZ- Konzept einen Aufschwung. Das Ziel des Programms war es eine best practice für die Kommerzialisierung technologischer Erfindungen festzuhalten[39, S. 57]. Der Blick auf die in Abbildung 4.2 dargestellte quantitative Entwicklung der Science- Parks in den USA zeigt einen starken Zuwachs in den 1980er Jahren. Dieses Wachstum ist u.a. auf das Inkrafttreten des sogenannten Bayh-Dole-Acts zurückzuführen[52, S. 203]. Das Gesetz – 1980 in den USA eingeführt – erlaubt es den Wissenschaftlern, die Resultate von staatlich geförderter Forschung patentieren und lizenzieren zu lassen ([43, S. 13], [68, S. 102]). Somit bildet der Bayh-Dole-Act für die Universitäten einen monetären Anreiz, den Technologietransfer mit der Industrie möglichst effizient zu gestalten. Vor Inkrafttreten des Gesetzes gehörten die von Universitäten und Hochschulen angemeldeten Patente derjenigen Bundesbehörde, die die Forschungsarbeit förderte. Mitunter als Folge des Bayh-Dole-Act schnellte die Anzahl der Patentanmeldungen in die Höhe[68, S. 100]. In Europa wurden die ersten TGZ – oft in einer Partnerschaft zwischen nationalen und regionalen Regierungsstellen, Privatunternehmen und Universitäten – in den späten 1960er und frühen 1970er Jahre gegründet. Wie in den USA stieg in den 80er und 90er Jahren deren Anzahl stark an, wobei die amerikanischen Vorbilder aus den USA eine grosse Rolle spielten[24, S. 1105]. In Grossbritannien wurde in den 1980er Jahren mit dem Bau von TGZ begonnen. Heute sind auf der Insel mehr als 40 Anlagen in Betrieb[33, S. 93]. In Italien sind es 34
- 35. 4. Definitionen und Datenlage Abbildung 4.2: Die Anzahl Science-Parks von 1951 bis 1998 in den USA[56, S. 1326]. gemäss des Verbandes der Science und Technology Parks Italien (APSTI) 31 Anlagen14. Österreich zählt 110 Technologie-, Impuls- und Gründerzentren.15 Der Bundesverband der deutschen Innovations-, Technologie- und Gründerzentren sowie Wissenschafts- und Technologieparks (ADT) zählt 154 Innovations- und Gründerzentren16. In der Schweiz wurde das erste TGZ im Jahre 1993 in Zürich eröffnet. Heute zählt der Verein Swiss- Parks.ch insgesamt 18 Mitglieder, wobei eines ein virtuelles TGZ ist und ein Mitglied in der Zwischenzeit zu einem Gewerbezentrum wurde.17 4.9.4. Übersicht möglicher Kernaufgaben Nach Felsenstein[31, S. 93 ff.] hat ein TGZ zwei Ziele: einerseits “to play an incubator role, nurturing the development and growth of new, small, high-technology firms, facilitating the transfer of university know-how to tenant companies, encouraging the development of faculty-based spin-offs and stimulating the developement of innovative products and processes” und andererseits die Aneignung der Eigenschaften “of a growth sector leading the area under question into a spiral of propulsive expansion”. Nur ein Innovationen generierendes Umfeld zu sein, reicht demnach nicht aus[31, S. 94]. Für eine Bestimmung der Kernaufgaben eines TGZ hilft die Orientierung an den vier Hauptelementen, anhand derer ein Gründerzentrum definiert werden kann.18 Diese Ele- mente lassen eine direkte Folgerung der Aufgaben und Pflichten eines TGZ zu.19 14 http://www.apsti.it, zuletzt besucht am 10. August 2008. 15 http://www.vto.at, zuletzt besucht am 10. August 2008. 16 http://www.adt-online.de, zuletzt besucht am 10. August 2008. 17 Vgl. dazu Kapitel 8. 18 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.1. 19 Vgl. dazu Peters (2004)[71, S. 83–91]. 35
- 36. 4. Definitionen und Datenlage Als Vermieter von Infrastruktur (Räumlichkeiten, Büroeinrichtungen etc.) inklusive administrativen Services hat das Management eine Reihe logistischer und adminis- trativer Aufgaben zu bewältigen, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Das professionelle Angebot an Coaching, bringt diverse Lehraufgaben, aber auch den Aufbau eines Netzwerks mit sich. Die Vermittlung der Netzwerk-Kontakte ist eine weitere Aufgabe. Des Weiteren gehört die Durchsetzung der Exit-Regeln in das Pflichtenheft des TGZ-Managements. Das Management muss dabei festlegen und erkennen, wann ein Mie- ter stark genug ist, um auf eigenen Beinen zu stehen und das Angebot des Zentrums nicht mehr benötigt. Eine weitere Aufgabe ist die Vorselektion. Die Entscheidung wer im Zentrum aufge- nommen wird und wem der Zugang verwehrt bleibt, ist Aufgabe des Managements des TGZ oder einer dafür geschaffenen Stelle. Die Aufgaben im administrativen und logistischen Bereich sind bei allen TGZ ziem- lich einheitlich. Das Set umfasst ein Angebot an Büroräumlichkeiten inkl. Einrichtungen, Hauswartung, Sekretariatsdienstleistungen sowie Empfang und Büro- bzw. Schreibarbei- ten ([14, S.269], [21, S.1215–1228], [63, S. 325–335], [77, S. 163–187]). Bei der Durchsetzung der Exit-Regeln lässt sich ebenfalls ein gemeinsamer Nenner finden. Die meisten TGZ formulieren diese formell und verlangen eine Kündigung des Mietvertrages nach drei bis fünf Jahren[12, S. 23]. Die Vorselektion, das Coaching und die Vermittlung von Kontakten sind die Aufgaben, welche vom TGZ-Management am unterschiedlichsten wahrgenommen werden[12, S. 23], daher werden sie wie folgt detailliert betrachtet. 4.9.5. Ausgewählte Kernaufgaben Selektion Der Selektion wurde in der Literatur am meisten Aufmerksamkeit geschenkt[39, 55 ff.]. Die Wissenschaftler sind sich dabei weitgehend einig, dass die gezielte Auswahl von Mie- tern eine zentrale Aufgabe von TGZ ist.20 Sie gilt als Basis für eine effektive Ressourcen- Allokation, die sowohl dem TGZ als auch der Wirtschaft zugutekommt.21 Die Abgrenzung zwischen Unternehmen, die Potenzial haben, aber schwach sind und jenen Unternehmen, denen nicht geholfen werden kann bzw. die keine Brutstätte mehr benötigen, ist äusserst schwierig. Ausgeprägte Marktkenntnisse sowie auch ein genaues Prozessverständnis der Start-up-Entwicklung sind dazu notwendig[59, S. 55 ff.]. Bezüglich der Selektionskritieren gibt es unterschiedliche Meinungen. Dies äussert sich in ihrer unterschiedlichen Gewichtung. Mögliche Indikatoren sind die technischen Kennt- nisse sowie die Führungserfahrung des Unternehmers bzw. des Mitarbeiterteams, die Charakteristik des angestrebten Marktes und die Eigenschaften des Produktes bzw. der Dienstleistung[12, S. 23]. 20 Vgl. dazu z.B. Colombo (2004)[24, S. 1103 ff.] sowie Peters (2004)[71, S. 83 ff.]. 21 Lumpkin et al. (1988)[59, S. 59 ff.] zitiert nach Bergek et al. (2008)[12]. 36
- 37. 4. Definitionen und Datenlage Abbildung 4.3: Selektionsstrategien nach Bergek et al. (2008)[12, S. 24]. Bergek et al. (2008) unterscheiden vier Selektionskriterien. Diese können zum einfache- ren Verständnis in einer Matrix dargestellt werden[12, S. 23] (vgl. dazu Abbildung 4.3). Auf der Y-Achse wird dabei zwischen Kriterien, die mit dem Potenzial der Unterneh- mensidee zusammenhängen und solchen, die sich auf die Eigenschaften des Unternehmers bzw. des Unternehmerteams stützen, unterschieden. Das erste Kriterium verlangt nach einer verlässlichen Einschätzung des Potenzials der Geschäftsideen. Dies ist nur möglich, wenn das TGZ-Management auf einen grossen Wissensbestand zurückgreifen kann. Für die Bewertung des Unternehmers bzw. der Unternehmerteams sind Menschenkenntnisse sowie eine genaue Vorstellung der Qualifikationen und Charaktereigenschaften, die der Initiant bzw. die Initianten haben müssen, erforderlich. Auf der X-Achse der Matrix unterscheiden Bergek et al. (2008) zwischen den beiden Strategien Den Gewinner herauspicken und Nur der Beste überlebt. Bei der ersten Stra- tegie orientiert sich das TGZ-Management an den Erfolgen, die die Bewerber bereits vorweisen können. Wird dies jedoch zu extensiv ausgeführt, läuft das TGZ Gefahr, eine Venture-Capital-Firma zu werden. Bei der zweiten Strategie werden die Kriterien offen vom TGZ-Management interpre- tiert und der Selektionsprozess wird dem Markt überlassen. Verständlicherweise bedingt dies eine grosse Aufnahmekapazität des TGZ[12, S. 23]. Mit Hilfe der Matrix lassen sich vier Selektionsstrategien ableiten. Anhand der Cha- rakteristiken der im TGZ eingemieteten Unternehmen, dem sogenanntem TGZ-Portfolio, lässt sich ablesen, welche Selektionspraktiken im jeweiligen Zentrum praktiziert werden[12, S. 24 ff.]. • Nur der Beste überlebt kombiniert mit Fokus auf die Idee: Das Portfolio umfasst eine grosse Anzahl von Unternehmen, deren Ideen noch nicht ausgereift sind und sich über mehrere Fachgebiete erstrecken. • Nur der Beste überlebt kombiniert mit Fokus auf Unternehmer: Das Portfolio ist vielfältig und beinhaltet engagierte Unternehmer, deren Firmen in unterschiedli- chen Bereichen tätig sind. • Den Gewinner herauspicken kombiniert mit Fokus auf die Idee: Daraus resultiert ein sehr diversifiziertes Portfolio. Die Ideen der Start-ups sind primär technologi- 37
- 38. 4. Definitionen und Datenlage scher Art, gut durchdacht und stammen von angesehenen Universitäten und Hoch- schulen. • Den Gewinner herauspicken und Fokus auf Unternehmer: Das Portfolio umfasst handverlesene Start-ups und sorgfältig evaluierte Unternehmer. Die Ideen stammen überwiegend von Universitäten und Hochschulen aus der Umgebung. Coaching Die Wichtigkeit von angebotenem Coaching als Ergänzung zu administrativen Dienstleis- tungen wird in der Literatur betont, wobei es eine Reihe von Coaching-Möglichkeiten gibt. Im Allgemeinen umfasst es Trainings und Hilfestellungen zur Entwicklung des Geschäfts. Hinzu kommen Beratungen im Bereich Rechnungswesen, Recht, Werbung, Leadership und Finanzierung ([14, S. 269], [21, S. 1215 ff.]). Dabei geht es gemäss Bhabra-Remedios und Cornelius (1988) aber nicht nur um die Verfügbarkeit des Coachings. Hackett et al. (2004) haben beobachtet, dass sich Coaching in Bezug auf die investierte Zeit, den Umfang und die Qualität unterscheidet[38, S. 41–54]. Rice (2004) definiert drei unterschiedliche Coaching-Arten. Dabei wird berücksichtigt, wer der Initiator des Coachings ist und ob dieses fortwährend oder punktuell ist[77, S. 171]. • Reaktives und episodisches Coaching: Der Mieter fordert die Hilfe selbst aktiv an. Die Hilfestellung ist dann entsprechend auf das konkrete Problem ausgerichtet und zeitlich begrenzt. • Proaktives und episodisches Coaching: Das Management des TGZ macht den ersten Schritt und berät den Unternehmer in informellen Ad-hoc-Beratungen. • Kontinuierliches und proaktives Coaching: Die Initiative kommt ebenfalls vom TGZ-Management. Der Mieter bekommt fortwährend Rückmeldungen und Ratschlä- ge sowie Interventionen. Die passende Strategie ist gemäss Bergek et al. (2008) eine Frage, wie sich das TGZ selbst definiert und welche Rolle sich das Zentrum im Innovationsprozess zuschreibt. Dabei gilt es konzeptionell festzulegen, wie gross der Einfluss des TGZ-Managements auf den Innovationsprozess der Start-ups sein soll[12, S. 23]. Versteht sich das TGZ als ein externer Moderator und überlässt die Gestaltung des Innovationsprozesses dem Start-up, ist der Einfluss entsprechend klein. Werden die eingemieteten Unternehmen vom TGZ- Management strikt durch den Entwicklungs- und Innovationsprozess geleitet, nimmt die TGZ-Leitung einen grossen Einfluss[12, S. 23]. Vermittlung Eine wichtige Aufgabe des TGZ ist es als ein Intermediär bzw. Vermittler zwischen den Start-ups und dem Innovationssystem aufzutreten[71, S. 83]. Das Zentrum versinnbild- licht eine Brücke zwischen den eingemieteten Unternehmen und deren Umgebung[62, S. 38
- 39. 4. Definitionen und Datenlage 280].22 Mit dieser Tätigkeit verfolgt das TGZ-Management das Ziel, Einfluss auf unter- nehmerische Talente und/oder Ressourcen zu nehmen ([14, S. 274], [35, S. 111 ff.]). Zu diesen gehören kritische Ressourcen wie Wissen, Technologie, Kapital, Arbeitskräfte etc. ([14, S. 284], [63, S. 327], [77, S. 171]). Mit dem Ziel, die Start-ups trotz ihrer Mängel in etablierte Netzwerke einzubinden, tritt das TGZ-Management als Kontaktvermittler auf und bringt die eingemieteten Un- ternehmen mit anderen Akteuren zusammen ([71, S. 88], [16, S. 24]). Bergek et al. (2008) verstehen dieses Networking auch als Netzwerkaufbau, den das TGZ-Management tätigen muss, um sich beim Coaching darauf abstützen zu können[12, S. 23]. Diese Vernetzungen bieten Zugang zu Informationen, Wissen und Erfahrungen, die für Start-ups sehr wertvoll sind und Unsicherheiten reduzieren[23, S. 192, 199]. Netzwerke können zwischen Start-ups und externen Akteuren wie beispielsweise poten- ziellen Kunden, Partnern, Arbeitnehmern, Universitäten und Finanzfachleuten bestehen ([14, S. 273 ff.], [22, S. 202], [39, 57]). Zusätzlich gibt es auch innerhalb der Start-up-Szene ein Netzwerk. Dieses ist beispielsweise für soziale Bedürfnisse und die Entwicklung von Agglomerationsvorteilen nützlich ([39, 57 ff.], [16, S. 24], [23, S. 190], [24, S. 1105]). Das TGZ-Management kann auch als institutioneller Mediator fungieren und so seinen Mietern helfen, institutionelle Rechtsansprüche (Gesetze, Traditionen, Werte, Normen und Regeln) richtig zu interpretieren oder gar zu beeinflussen[12, S. 25]. Auch kann sich das TGZ-Management darum bemühen, dass sowohl die Sichtbarkeit als auch die Glaub- würdigkeit und das Verständnis von Start-ups in den Augen der externen Akteure erhöht wird. Damit helfen sie den Start-ups, soziale Akzeptanz und Legitimität zu erlangen ([14, S. 286 ff.], [23, S. 204]). Bei einigen TGZ-Managements beschränkt sich die Mediationsaktivität auf gewisse Regionen. Andere wiederum arbeiten in internationalen Dimensionen, beschränken sich jedoch auf ein technologisches Feld[22, S. 206]. 4.9.6. Problematik der Leistungserfassung Die Evaluation von TGZ ist aus mehreren Gründen äusserst schwierig. Bei Vergleichsstu- dien ist die Hauptschwierigkeit die Bestimmung der Unternehmen der Kontrollgruppe, denn diese müssen mit den TGZ-Mietern möglichst vergleichbar sein, dürfen aber nicht in einem TGZ angesiedelt sein[39, S. 60]. Auch fehlt es an einheitlichen, aussagekräftigen Indikatoren, anhand deren die TGZ-Leistung gemessen werden kann. Dies äussert sich in den wissenschaftlichen TGZ-Studien[12, S. 22]. Allen und McCluskey (1990) beispielsweise analysierten bei 127 TGZ in den USA den Belegungsgrad der vermieteten Räumlichkeiten und die Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze. Zudem ordneten sie die TGZ in ein gestuftes Kategorienmodell ein.23Allen et al. (1990)[4, S. 61–77] zitiert nach Bergek (2008)[12, S. 22] Phillips (2002) hingegen analysierte in seiner Studie die Einkünfte der Mieter, die Anzahl der Patentanträge pro Unternehmen sowie die Anzahl der gescheiterten Firmen in den unterschiedlichen Typen von TGZ[73, S. 299–316]. 22 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.1. 23 ( 39
- 40. 4. Definitionen und Datenlage Die wahrscheinlich umfassendsten Leistungsstudien führte Mian (1996a) durch. Ne- ben den Standardindikatoren analysierte er zusätzlich die Effektivität der Management- Taktiken sowie den Nutzen der vom TGZ angebotenen Dienstleistungen ([63, S. 325–335], [64, S. 191–208], [65, S. 251–285]). Ein weiteres Problem in der Evaluation von TGZ ist, dass die Anwendung gleicher Indikatoren bei mehreren TGZ per se problematisch ist, zumal es keine identischen TGZ gibt[4, S. 64]. Um den Ansprüchen der unterschiedlichen Stakeholder zu genügen, definie- ren die TGZ meist mehrere Ziele, wobei diese von Zentrum zu Zentrum sehr unterschied- lich sein können. Aber auch TGZ, die annähernd identische Ziele verfolgen, unterscheiden sich in deren Prioritätensetzung[14, S. 265 ff.]. Dies wiederum aus dem Grund, da das Management bzw. die Initianten eines TGZ die Strategie an den unterschiedlichen An- sprüchen externer Akteure ausrichten müssen[64, S. 194]. Für einen handfesten Vergleich unterschiedlicher Typen von TGZ müssen daher die erfassten Output-Ergebnisse verschieden gewichtet werden[11, S. 322 ff.]. Des Weite- ren bedingt ein solcher Vergleich, dass die Leistungsindikatoren den Zielen angepasst werden[12, S. 22]. Ist z.B. das Ziel eines TGZ, möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen, dann wird der aussagekräftigste Indikator die Anzahl neuer Arbeitsplätze sein. Setzt sich ein Zentrum nun aber zum Ziel, Forschungsresultate möglichst rentabel auf den Markt zu bringen, liefern die Verkaufszahlen der eingemieteten Unternehmen die validesten Daten. In diesem Sinne hat wohl jeder Indikator seine Berechtigung. Entscheidend ist, dass er im richtigen Kontext angewendet wird. Die Auswahl der Messkritierien muss daher sehr sorgfältig und mit Berücksichtigung der Ziele erfolgen[12, S. 22]. In der Diskussion der TGZ-Evaluation gibt es aber auch die Ansicht, dass ohne Be- rücksichtigung der jeweiligen Ziele eine ausreichende Bewertung möglich ist. Regierungs- stellen beispielsweise, die sich primär für die neu geschaffenen Arbeitsplätze interessieren, werden vermutlich zufrieden sein, wenn ihnen eine entsprechende Rangliste der TGZ vor- gelegt wird. Die Ziele der TGZ spielen in diesem Fall eine untergeordnete Rolle[12, S. 22]. Werden bei einem Leistungsvergleich mehrerer TGZ miteinander verglichen jedoch die unterschiedlichen Ziele nicht berücksichtigt, kann nicht erklärt werden ob die Ursa- che unterschiedlicher Resultate aufgrund der unterschiedlichen Praxis oder aufgrund des unterschiedlichen Zielfokus zustande kamen[12, S. 22–23]. Auch widerspricht eine Vernachlässigung der Ziele der Evaluationstheorie, welche ver- langt, dass die Leistung jeweils im Zusammenhang mit dem angestrebten Ziel gemessen wird[87, S. 10]. Im Falle der TGZ bedingt dies, dass das Konzept und der Prozess der Leistungserstellung bei der Evaluation entsprechend berücksichtigt werden[12, S. 22]. Lediglich den Output einer Aktivität zu messen, reicht demnach nicht aus. 4.9.7. Erfolgsfaktoren von TGZ Vorschlag von Byung-Joo Kang Byung-Joo Kang (2004) versuchte die Erfolgsfaktoren eines TGZ zu bestimmen. Dabei unterscheidet er weiche und harte Faktoren[52, S. 206]. Zu den weichen Faktoren gehören: • Angemessenheit der Ziele 40
- 41. 4. Definitionen und Datenlage • Fähigkeiten der im TGZ eingemieteten Unternehmen • Netzwerk zwischen den in den TGZ eingemieteten Unternehmen und den umlie- genden Forschungs- und Ausbildungsstätten Zu den harten Faktoren gehören: • Unterstützung des TGZ von aussen • Dienstleistungen und Anlagen, die im TGZ geboten werden Einige Autoren stellen andere Erfolgsfaktoren in den Vordergrund. Für Hilper (1991) sind Jungunternehmertum, Management-Fähigkeiten, das Gründungskonzept, der Be- trieb des TGZ und die politische Atmosphäre die entscheidenden Faktoren[29, S. 40]. Für Felsenstein (1994) ist die geografische Nähe zu Universitäten ausschlaggebend[31, S. 96] und für Minshall (1983) ist die Verfügbarkeit von Arbeitskräften im Hightech-Bereich entscheidend[66, S. 158]. Byung-Joo Kang (2004) teilt die von ihm vorgeschlagenen Erfolgsfaktoren in die fol- gende drei Kategorien ein[52, S. 206]: Standort Die Präsenz einer bedeutenden technischen Hochschule oder Universität in der Nähe des TGZ ist ein entscheidender Faktor für dessen Erfolg. Weiter ist es wichtig, dass das Zentrum eine gute verkehrstechnische Anbindung mit Zugang zu Autobahn, Flughafen und Wohngegend hat. Eine gute schulische Infrastruktur und Zugang zu einem Fiberglas- Kommunikationsknotenpunkt sind weitere Erfolgsfaktoren. Infrastruktur Das Fundament von Silicon Valley war laut Rogers (1985) das sehr gut funktionieren- de Informationsnetzwerk. Technische Ideen konnten über dieses Netzwerk schnell und effizient ausgetauscht werden[78, S. 239]. Weitere Erfolgsfaktoren sind Brütezentren für Start-ups, Innovationszentren und Forschungslabors. Günstige Land- und Mietpreise sind ebenfalls förderlich[52, S. 207]. Fördermassnahmen/-mechanismen Hierzu zählen kollaborative Beziehungen zwischen den Universitäten, Unternehmen und Forschungsinstituten sowie die Ansiedlung von Hightech-Unternehmen in der Nähe des TGZ und starkes Leadership.Die Verfügbarkeit von Venture Capital ist ein weiterer sehr wichtiger Faktor, da Start-ups in der Anfangsphase auf Kapital angewiesen sind[92]. 41
- 42. 4. Definitionen und Datenlage 4.9.8. Nutzen von TGZ Nutzen für eingemietete Start-ups Zu den Hauptargumenten, die für die Gründung eines TGZ sprechen, zählen der erleich- terte Zugang der Mieter zu wissenschaftlichem Know-how und Forschungsresultaten, der vereinfachte Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in kommerzielle Produkte, sowie die Nähe zu Labors und anderen Forschungseinrichtungen der Universitäten[2, S. 364]. Diese Argumente basieren mehrheitlich auf Studienresultaten aus den USA, die gezeigt haben, dass Wissensspillover von Universitäten die Innovationstätigkeit der umliegenden Unternehmen fördern.24 Jaffe (1989) konnten dies anhand des positiven Zusammenhangs von universitärer Forschungsarbeit und der Patenttätigkeit von im gleichen Staat wie die Universität angesiedelten Unternehmen feststellen ([50, S. 957 ff.]. Gemäss Acs et al. (1994) profitieren die kleinen Unternehmen am meisten von solchen Wissensspillover- Effekten[3, S. 340]. Ein weiterer Mehrwert den die in einem TGZ eingemieteten Unternehmen haben, lässt sich aufgrund der Erkenntnisse der industriellen Standortlehre erklären. Die enge An- siedlung von Unternehmen, die in gleichen oder ähnlichen Branchen tätig sind, führt zu sogenannten Agglomerationsvorteilen.25 Dies sind beispielsweise Kostenvorteile, die dank reduzierter Transportkosten entstehen[37, S. 14]. Die Konzentration auf einen Standort fördert zudem den Auf- und Ausbau des Kontaktnetzwerks[71, S. 83]. Dies wird in der zeitgenössischen Literatur oft als sogenanntes Networking bezeichnet. Das Kontaktnetz- werk wird anhand unterschiedlicher Massnahmen vom TGZ-Management gezielt gepflegt und für die Mieter zugänglich gemacht. Ein weiterer Mehrwert für die eingemieteten Unternehmen sind die vom TGZ-Management angebotenen Trainings- und Businesspro- gramme.26 Zudem profitieren die Mieter von passenden Einrichtungen, flexiblen Mietbe- dingungen sowie technischen und wirtschaftlichen Dienstleistungen. All diese Faktoren können das Potenzial der Jungunternehmer unterstützen[24, S. 1105] und machen ein TGZ zu einer optimalen Lokalität für Jungunternehmer. Stuart Macdonald (1987) von der Queensland Universität in Australien widerspricht jedoch dieser These. Er stuft den Marktvorteil, den sich Start-ups dank ihrer Nähe zu Universitäten verschaffen, als klein bzw. gar inexistent ein. Auch zweifelt Macdonald an der Existenz von Agglomerationsvorteilen, welche durch die konzentrierte Anordnung zustande kommen sollten[60, S. 26 ff.]. Tatsächlich ist die Frage, ob ein TGZ das Jungunternehmertum fördert oder nicht, unklar. Zumal die Studien, die TGZ-Mieter mit ähnlichen Firmen, die ausserhalb solcher Zentren lokalisiert sind, verglichen haben, unterschiedliche Resultate ergaben. Dies ist u.a auf die Messproblematik zurückzuführen.27 Bis anhin konnte den TGZ-Mietern weder ein grösserer Output an Produkten und Dienstleistungen sowohl in neuen als auch in existierenden Märkten, noch eine höhere Anmeldungsrate von Patenten empirisch nachgewiesen werden[24, S. 1105]. Auch bei 24 Vgl. dazu Abschnitt 4.4. 25 Vgl. dazu Abschnitt 4.6. 26 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.5. 27 Vgl. dazu Kapitel II. 42
- 43. 4. Definitionen und Datenlage dem Beschäftigungsgrad von akademischem Personal, dem Sponsoring von Forschung, der Benutzung von Test- und Analyseinstrumente der Universitäten, der Beschäftigung von Hochschulabsolventen und der Umsetzung von Studentenprojekten sind in TGZ ein- gemietete Unternehmen und Unternehmen, die nicht in einem TGZ angesiedelt sind vergleichbar[24, S. 1106]. Zudem gibt es keine Studie, die zeigt, dass TGZ-Mieter in- novativer sind als vergleichbare Unternehmen, die nicht in einem TGZ angesiedelt sind und von dessen Angeboten profitieren können[24, S. 1105]. Löfsten und Lindelöl (2002) befragten diesbezüglich schwedische Unternehmen, die in einem TGZ eingemietet sind sowie Unternehmen, die nicht in einem TGZ angesiedelt sind. Sie dabei stellten fest, dass die TGZ-Mieter scheinbar nicht fähig sind, die durch das Kontaktnetzwerk entstandenen Ressourcen in einen höheren FuE-Output (Patente etc.) umzuwandeln[57, S. 875]. Dennoch gibt es einige Studien, die eine positive Wirkung eines TGZ auf seine Mie- ter wenn auch nur in bescheidener Form aufzeigen konnten. Ein solches Beispiel ist die frühe Studie von Monck et al. (1998). Sie untersuchten bei britischen Unternehmen den prozentualen Anteil qualifizierter Wissenschaftler und Ingenieure, der im Unternehmen beschäftigten Personen gemessen am Verhältnis der FuE Intensität mit dem erwirtschaf- teten Umsatz. Die Forscher stellten fest, dass dieser prozentuale Anteil bei im TGZ eingemieteten Unternehmen höher liegt als bei Firmen einer Kontrollgruppe, die nicht in einem TGZ eingemietet sind[67, S. 61–77]. Dieses Resultat konnte jedoch in einer späteren Studie nicht bestätigt werden[94, S. 45–62]. Ein weiteres Beispiel ist die Forschungsarbeit von Braun und McHone (1992). Sie fanden heraus, dass Unternehmen, die im Central Florida Research Park eingemietet sind, eher dazu neigen ihre Produkte auch in Kanada zu verkaufen als ähnliche Unternehmen, die ausserhalb des Zentrums lokalisiert sind[15, S. 135–147]. Westhead und Story (1995) konnten empirisch feststellen, dass in Grossbritannien zwi- schen 1986 und 1992 die in TGZ eingemieteten Unternehmen ein grösseres Wachstum aufwiesen als vergleichbare Unternehmen, die nicht einem Zentrum angehörten[95, S. 345 ff.]. Die Resultate können jedoch auch als Erfolg für die Selektion der Kandidaten gewer- tet werden.28 Auch zeigen die Daten, dass die im TGZ eingemieteten Unternehmen eine festere Verbindung zu akademischen Institutionen haben als Unternehmen, die nicht im TGZ angesiedelt sind. Auch Löfsten und Lindelöf (2002) folgerten aus den Daten ihrer Studie, dass die in den schwedischen TGZ eingemieteten Unternehmen eine verhältnismässig starke Verbindung zu Universitäten haben. Zudem konnte das Autorenduo eine Zunahme der formellen Be- ziehungen durch die Ansiedlung in einem TGZ feststellen. Dabei hielten sie fest, dass der Zugang zu akademischen Ressourcen überwiegend auf einfachen Verträgen, der Einstel- lung von Absolventen und informellen Kontakten basiert[57, S. 870]. Diese Erkenntnis überschneidet sich mit den Aussagen von Westhead und Story (1995). Auch sie stellten beim genauen Blick auf die Verbindungen zwischen TGZ-Unternehmen und Universitäten fest, dass diese mehrheitlich informeller und praktischer Natur sind[95, S. 345–330]. 28 Vgl. dazu Abschnitt 4.9.5. 43
